
Goldene Zeiten der Literatur?
Eine Dissertation zur rumänischen Auseinandersetzung mit der Zwischenkriegszeit
Nach der Wende von 1989 blühte die Erinnerung an die Zwischenkriegszeit als einer kulturell reichen, vom Kommunismus noch nicht zerstörten rumänischen Kulturepoche regelrecht auf. Einen Einblick in die besonderen Bedingungen dieser Blüte
in den führenden rumänischen Zeitschriften der 1990er Jahre bietet die Dissertation von Gundel Große. Sie untersucht am Beispiel von zwei maßgeblichen literarischen Zeitschriften den Diskurs über die "wiederentdeckten" Jahre der Kulturblüte Rumäniens nach dem Ersten Weltkrieg. Convorbiri Literare und Viața Românească hatten nach unterschiedlich langer Laufzeit sich nach der Wende neu formiert und stellten zwei der wichtigsten Diskursorte der sich erst allmählich bildenden neuen Öffentlichkeit dar. CL (Erscheinungsort Iași) wurde im 19. Jahrhundert (1867) von der Junimea um Titu Maiorescu gegründet als theoretisch-literarisches Organ der bedeutenden literarischen und politischen Gruppe Junimea. Nach 1989 erfuhr die CL diverse Veränderungen im Erscheinungsmodus und in der Redaktion, behielt aber eine eher traditionelle Ausrichtung bei. VR hingegen wurde 1906 als eine modernistische und politische Zeitschrift ebenfalls in Iași von dem Politiker, Juristen und Universitätsrektor Constantin Stere gegründet, wechselte 1930 nach Bukarest, wo sie nach 1945 und nach 1989 weiterhin vom Schriftstellerverband veröffentlicht wird.
Diese beiden Zeitschriften und ebenso die literaturwissenschaftlichen Besonderheiten von Zeitschriften werden in der Diss. in ihrem politischen und literarischen Profil vorgestellt sowie die ökonomisch-gesetzlichen Voraussetzungen ihrer Publikation. Bereits 2015 hatte
Rumänien anlässlich einer Gesetzesänderung eine lebhafte Diskussion um die Zukunft von Kulturzeitschriften und ihre Förderung durch staatliche Einrichtungen.
Der größte Teil der Darstellung (S. 38-125) widmet sich nach der Exposition der beiden Zeitschriften jener Zwischenkriegszeit als besonderer Epoche in der rumänischen Literatur- und Ereignisgeschichte. Bereits der Hinweis auf den bis heute hochgeschätzten Lyriker Octavian Goga verbindet die politische Entwicklung mit der Literatur, denn Goga amtierte 1937/38 eine sehr kurze, aber einschneidende Zeit als Premierminister zusammen mit dem Antisemiten A.C. Cuza - wegen ihrer rassistischen Gesetzgebung mit desaströsen Folgen für die Entwicklung des Landes. Goga ist für die Autorin eines der Beispiele für die nicht seltene Identifikation von Autoren mit politisch (rechts)"extremem Gedankengut" (39). Die Gemengelage dieser Verbindungen von politischer Einstellung und Literatur stellt Große am Beispiel der beiden zentralen Kritiker Eugen Lovinescu und George Călinescu und ihrer Verwicklung in die Diskussionen der jungen Generation um die Kriterion-Gruppe dar, aus der die bis heute immer wieder herausgestellte Dreiergruppe Eliade, Cioran, Ionescu hervorgegangen ist. Lovinescu trat als Herausgeber der Zeitschrift Sburătorul bereits kurz nach dem Ersten Weltkrieg als Wegbereiter modernistischer Strömungen in der rumänischen Literatur hervor. Seinen Ruf als Literaturkritiker, aber auch als Deuter der rumänischen Geschichte erwarb sich der in Fălticeni geborene Lovinescu mit zwei umfangreichen Publikationen: der dreibändigen Istoria civilizației române moderne (1924-25; Geschichte der modernen rumänischen Zivilisation) und einer fünfbändigen Istoria literaturii române contemporane (1926-29; Geschichte der zeitgenössischen rumänischen Literatur), in denen er sowohl eine Orientierung an den westlichen Kulturen propagierte, wie auch das Augenmerk auf die historische Veränderung der literarischen Konzepte in den jeweiligen Generationen lenkte. Offen sprach sich Lovinescu für einen Synchronismus aus, demzufolge eine Kultur wie die rumänische durchaus die westliche nachahmen solle, um sich auf die Höhe der Zeit zu schwingen. Sein Hauptkritiker war der Historiker und Politiker Nicolae Iorga, der eher autochthone, an vorgeblich rumänischer Eigenheit orientierte, zeitweise auch stark antisemitische Konzepte vertrat. In gewisser Weise Nachfolger Lovinescus wurde der an der Universität Iași lehrende George Călinescu, der über Eminescu arbeitete und auch als Romancier hervortrat. Durch ihn wurden die Zwischenkriegsdiskussionen in die komplexe Nachkriegszeit perpetuiert. Sein Hauptwerk stellt die bis heute immer wieder aufgelegte monumentale Istoria literaturii române de la origini până în prezent (1941; Geschichte der rumänischen Literatur von den Ursprüngen bis zur Gegenwart) dar. Wie Große zeigen kann, geben die Theorien dieser beiden Kritiker ein weitreichendes Feld zur Diskussion der intellektuellen Landschaft der Zwischenkriegszeit und ihrer Mentalität ab. Nicht nur, weil sie bestimmte Aussagen über das kulturelle Selbstverständnis der "jungen" Nation abgaben, sondern auch weil sie auf konträre Positionen trafen, die insbesondere die politisch fatalen Ansichten der Schüler Nae Ionescus übernahmen. Eliade, Cioran, Noica und einige andere als Vertreter einer "Jungen Generation" ließen sich auf die identitätspolitischen Theorien der faschistischen Eisernen Garde ein und führten den Diskurs über das Selbstverständnis auf nationalistische und antisemitische Abwege, was der zunächst ebenfalls zur Gruppe Ionescus gehörende Schriftsteller Mihail Sebastian öffentlich in Frage stellte.
Eingehender werden diese Fragen auch im Kapitel über den specific românesc (nationales Spezifikum) diskutiert, das merkwürdigerweise seine besondere Rolle in der rumänischen Debatte behalten zu haben scheint. Es gehört zu jenen von Literaturwissenschaftlern wie Mircea Martin oder dem Historiker Lucian Boia immer wieder beobachteten "Paradoxa" oder psychologischen "Komplexen" rumänischer Kulturentwicklung wie dem der Inferiorität, der verspäteten Entwicklung, der sprachlichen Isolation u.a. Sie werden erweitert durch die Position, die Intellektuelle in der Frage des Verhältnisses zu Europa bzw. dem Balkan einnehmen. Auch diese wurden nach 1989 intensiv in den beiden Zeitschriften aus verschiedenen Blickwinkeln geführt.
Damit nähert sich die Studie der Aktualität der Zwischenkriegszeit und ihrer Debatten auch nach dem Ende des Kommunismus. Mit der Öffnung für neue Einflüsse aus dem Westen erhielten diese genannten Diskurse neue Perspektiven und Aspekte. In den CL wurde explizit gefragt: "Was ist ein rumänischer Schriftsteller?" (99) und das Verhältnis zur Vergangenheit der Zwischenkriegszeit und zum gegenwärtigen Exil thematisiert, während in VR wieder einmal das Spezifikum der rumänischen Kultur zu fassen versucht wurde. Die Dichterin Nora Iuga wies wie viele andere darauf hin, dass die "Komplexe" und "Paradoxa" nicht verschwunden und Inferiorität, Marginalisierung, Desynchronisation weiterhin aktuelle Themen seien. Als zentrales Mittel dagegen schlug Florin Mihăilescu die Erhöhung der Zahl von Übersetzungen aus dem Rumänischen vor, um damit im Westen sichtbar zu werden.
Ausgehend von diesen Fragestellungen zwischen Nach-1989, Exil, Zwischenkriegszeit bestand eine weitere Komplizierung in der Tatsache, dass Teile des Exils in der kommunistischen Zeit frühere Anhänger der faschistischen Legionäre gewesen waren, im Westen aber durch ihre Arbeiten zu den berühmtesten rumänischen Autoren aufstiegen wie Cioran oder Eliade. Andere nicht-legionäre Exilierte hatten über Publizistik und Radiosendungen den Widerstand gegen das kommunistische Regime gestärkt und wie etwa Monica Lovinescu (Tochter des Kritikers) und Virgil Ierunca hohes Ansehen im Land gewonnen. Kritisch hinterfragt wurden nach 1989 in den beiden Zeitschriften auch das heute so aktuelle Thema des 'richtigen' Verhaltens zwischen Ethik und Ästhetik am Beispiel von Călinescu, Arghezi, Sadoveanu u.a., die in der kommunistischen Diktatur hohe Ämter einnahmen. Einige AutorInnen warfen ihnen diesen "Pakt mit dem Teufel" als unmoralisch und auf das Werk abfärbend vor. Dieser eigentliche Kern der Thematik der Studie ist aufgeteilt in 2 Kapitel zu "ideologischen Problemen": Einmal geht es um die Auseinandersetzung mit Călinescu und seiner Wirkung auf bzw. Interpretation von Debatten um die Zwischenkriegszeit und die damit implizierten Positionen zu den politischen Parteinahmen und der Kritik am kommunistischen Regime. Zum anderen geht es um die Position von Mihail Sebastian und damit um den Antisemitismus der Jungen Generation der Zwischenkriegszeit und ihre politischen Fehler. Zentrale Fragen der Literaturgeschichten von Lovinescu und Călinescu führen zu generellen und spezifischen Diskussionen über den Anteil der jüdischen SchriftstellerInnen an der rumänischen Kultur und darüber hinaus wiederum zur vermeintlichen "rumänischen Identität" in der Literatur.
Es wird deutlich, dass Großes Diss. eine vielfältige Auswahl an Positionen und Material zu den im rumänischen Kulturbetrieb häufig diskutierten "großen" Fragen um die eigene Identität und die Begründungen für das literarische Tun in Vergangenheit und Gegenwart aufbereitet und damit wichtige Einblicke in diese Fragestellungen bietet. Es kommen zentrale Diskurse zum Selbstverständnis nach 1989 zur Sprache und werden ihrer Komplexität entsprechend differenziert dargestellt. Vielleicht wäre in der ein oder anderen Diskussion die Zurückhaltung der Vf.in besser einer dezidierteren Stellungnahme und Profilierung gewichen, wenn etwa vom "jüdischen Problem" die Rede ist, wobei es sich doch eher um ein Problem der Mehrheitsgesellschaft mit einer Minderheit handelt, dennoch kann die Arbeit durch ihren Ansatz die Kenntnis über und das Verständnis von rumänischer Kultur und Denkweisen nach der Wende von 1989 perspektivenreich fördern.
Gundel Große: Literaturgeschichte im Prozess (1990-2000). Die Auseinandersetzung rumänischer Literaten mit der Zwischenkriegszeit. Berlin: Frank&Timme 2023 (Forum: Rumänien 46), 212 Seiten, ISBN 978-3-7329-0942-1

Mihai Șora gestorben
Philosoph und später Aktivist
Im Alter von 106 Jahren starb am 25. Februar 2023 in Bukarest der Nestor der rumänischen Philosophie Mihai Șora. Șora wurde im österreichisch-ungarischen Banat geboren, besuchte das Lyzeum in Temeswar, studierte dann in Bukarest Mathematik und Philosophie bei den rechtsgerichteten Professoren Nae Ionescu und Mircea Vulcănescu, aber auch bei Tudor Vianu sowie bei Ionescus damaligem Assistenten Mircea Eliade. 1939 heiratete er Mariana Klein, mit der er 74 Jahre verheiratet blieb und mit einem Stipendium des französischen Staates nach Paris ging. Hier kam er in Kontakt mit den rumänischen Exilanten und Studenten Ionescus, Cioran, Ionescu, Constantin Noica. Der Einmarsch der deutschen Truppen veranlasste das junge Paar nach Süden zu flüchten und die Kriegsjahre in Grenoble zu verbringen. Hier hatte der junge Philosoph Kontakte zur kommunistischen Résistance und schrieb an seiner Dissertation zu Pascal. Nach dem Krieg fiel Șora mit ersten Arbeiten auf Französisch auf (Du dialogue intérieur. Fragment d’une anthropologie métaphysique) und kam 1948 allein nach Rumänien zurück, um seine Eltern wieder zu sehen. Allerdings machten die kommunistischen Machthaber ihm eine Rückkehr nach Frankreich unmöglich, so dass seine Familie ebenfalls nach Rumänien kam. Sein Arbeitsplatz wurde nach einer kurzen Tätigkeit im Aussenministerium unter Ana Pauker die Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, wo er die populär-legendäre Taschenbuchreihe Biblioteca pentru toți ins Leben rief; für sein Buch Sarea pământului erhält er 1979 den Preis des Schriftstellerverbandes. Șora gehörte nach der Wende, als er kurze Zeit auch Kulturminister in der ersten Regierung Petre Roman war, zu den Begründern des einflussreichen zivilgesellschaftlichen Grupul pentru Dialog Social. Seine aus einer früheren linken Orientierung entwickelte zivile Haltung wurde mehrfach deutlich im Engagement gegen die Kandidatur des Rechtsextremen Vadim Tudor und vor allem in den letzten Jahren in der Unterstützung der #rezist!-Bewegung gegen die PDS-Versuche des Umbaus des Staates zugunsten der eigenen Machterhaltung. Sei es persönlich auf der Straße, sei es durch Mitteilungen in den sozialen Medien nahm Șora lebhaft teil an dem Widerstand gegen die Abschaffung von politischen Rechten.
Nach dem Tod von Mariana 2011 im Alter von 94 Jahren, die bereits 1979 mit den drei Kindern nach Deutschland gegangen war, heiratete Șora
2014 die 47-jährige Schriftstellerin Luiza Palanciuc. Der Philosoph und Essayist, Ehrenmitglied der Rumänischen Akademie und Ehrenbürger der Stadt Bukarest, wurde auf dem Friedhof Bellu in Bukarest
beigesetzt.

"Der Pruth erzählt ein / anderes Gesicht"
Zum 100. Geburtstag des bukowina-israelischen Lyrikers Manfred Winkler
Ende 1958 erhält in Temeswar/Timișoara ein Schriftsteller seine Ausreisepapiere – er kann aus dem kommunistischen Rumänien nach Israel ausreisen: Mit 36 Jahren noch einmal völlig neu anfangen, eine neue Schrift und Sprache lernen, sich völlig neu einrichten. Manfred Winkler hatte davor
geheiratet, seine Ehefrau Herma durfte aber erst ein Jahr später ihm nachfolgen. Bis zur Ausreise hatte Winkler nach einer Phase als Arbeiter und technischer Angestellter in einer Metallfabrik sich auch als Autor hervorgewagt: 1956 erschien sein Erstling Tief pflügt das Leben im staatlichen ESPLA-Verlag in Bukarest – Gedichte, die vermieden, den Vorgaben des stalinistischen Literaturbetriebs zu widersprechen. Es folgten zwei Kinderbücher: Fritzchens Abenteuer und Kunterbunte Verse 1958. Winkler galt als Jungautor der deutschen Minderheit, der insbesondere auch im Rundfunk auftrat und bei einer offiziellen Zusammenkunft junger Autoren 1956 den Siebenbürger Hans Bergel persönlich kennenlernte, mit dem er fast 40 Jahre später erst wieder in Kontakt kommen sollte. Winkler selbst aber kam wie seine Ehefrau Herma aus der Bukowina, geboren am 27. Oktober 1922 in Putyla in den Waldkarpaten in die Familie eines jüdischen Rechtsanwalts. Durch die Schulausbildung in Czernowitz dürfte der spätere Autor auch die Atmosphäre der späten 1930er Jahre erlebt haben, in der jüdische deutschsprachige Dichter wie Alfred Margul-Sperber, Immanuel Weissglas, Moses Rosenkranz, Rose Ausländer debutierten, zugleich aber die gesellschaftliche Atmosphäre durch den Antisemitismus der faschistischen Eisernen Garden allmählich vergiftet wurde und der jüdischen Bewohnerschaft die Existenz zunehmend erschwerte.
Das Unglück der Familie Winkler rührte dann aber von der sowjetischen Besetzung 1940-41 her, zu deren Ende Vater, Mutter und älterer Bruder nach Kasachstan bzw. in den GULAG deportiert wurden. Der Vater nahm sich in der Deportation das Leben, Mutter und Bruder überlebten. Manfred Winkler entging dieser Verschleppung, wurde dann aber in rumänische Arbeitslager deportiert. Als 1946 die Möglichkeit bestand, das sowjetisch gewordene Czernowitz zu verlassen, kam Winkler nach Temeswar.
Mit seiner Ausreise nach Israel gewann der Dichter mit dem Hebräischen jene neue Sprache, in der er bereits nach kurzer Zeit Aufsehen erregende Lyrik schrieb, für die er 1999 den Staatspreis des Ministerpräsidenten erhielt. Zudem genoss er als Leiter des Theodor Herzl-Archivs großes Ansehen im Land. Winkler hatte als Nestor des Kreises deutschsprachiger LyrikerInnen im "Lyris"-Kreis weiterhin in seiner Muttersprache gedichtet und nach der Wiederbegegnung mit Hans Bergel kam es 40 Jahre nach seinem Debut auch wieder zu deutschsprachigen Buchveröffentlichungen. Wiederholt bezeugte Winkler seine Beeinflussung durch das Werk Paul Celans (den er erst 1969 bei dessen Israel-Besuch persönlich kennenlernte), das er bereits vorher durch maßgebliche Übersetzungen ins Hebräische intensiv kennengelernt hatte. Neben Übersetzungen in und aus mehreren Sprachen hat der vielfach begabte Dichter auch Bildhauerei und Malerei betrieben. Hochbetagt starb Manfred Winkler 2014 in seinem Haus bei Jerusalem.
Seine in den Verlagen Rimbaud und Edition Noah&Block publizierten Gedichtbände haben die LiteraturwissenschaflterIn Monica Tempian und Hans-Jürgen Schrader durch weitere Gedichte aus dem Nachlass ergänzt in einem Band gesammelt publiziert. Zu seinem 100. Geburtstag veranstaltet das Franz Rosenzweig Minerva Research Center und das Goethe-Institut in Jerusalem Ende November 2022 eine wissenschaftliche Tagung zum Werk des rumänisch-israelischen Dichters deutscher und hebräischer Sprache aus der Bukowina.
Manfred Winkler: Haschen nach Wind. Die Gedichte. Hg. v. Monica Tempian und Hans-Jürgen Schader. Arco Verlag Wien/Wuppertal 2017 (Reihe Israel in Europa, Bd. 2), 878 Seiten, ISBN 978-3-938375-87-7
Originalausgaben bei:

Demographische und
juristische Komplexität
Eine juristische Studie über die Minderheiten in Rumänien
Es hat sich herumgesprochen, dass Rumänien nicht nur eine große Zahl von ethnischen, sprachlichen und religiösen Minderheiten in seinem Staatsgebiet aufweist, sondern dass diese auch die Möglichkeit besitzen, im Parlament mit mindestens 1 Abgeordneten vertreten zu sein. Wie aber der juristische und politische Status der unterschiedlich großen Minderheiten genau beschrieben werden kann, ist im Detail sehr viel komplizierter und facettenreicher. Daher ist diese Diss., die sich der juristischen Lage des Minderheitenschutzes in Rumänien widmet, sehr willkommen.
Die Autorin bietet zunächst ausführlich den Rahmen des Themas im Referat einmal der unterschiedlichen, als Minderheiten in Rumänien anerkannten Gruppen. Dies geschieht vor dem Hintergrund eines kurzen Überblicks über die Entstehung des modernen Rumäniens im 19. Jahrhundert, in dem bereits die Frage des Umgangs mit der jüdischen Bewohnerschaft bzw. ihrer Zuwanderung eine zentrale Problematik der Staatsverständnisses darstellte. Interessant ist in der kurzen Auflistung bereits, dass sich in den Volkszählungen 2002 und 2011 im Detail unterschiedliche Bilder präsentierten: 2002 wurden noch einige kleine Gruppen erwähnt (Gagausen, slawische Mazedonier, Slowenen, Albaner), die unter 0,01% der Bevölkerung ausmachten - 2011 tauchen diese nicht mehr auf, dafür aber Chinesen, Tschangos, Mazedonier. Moldovan nennt Tschangos und Aromunen "besondere Gruppen" (34), da sie einerseits in der Herkunft nicht eindeutig zu bestimmen sind, zum anderen aber zu größeren Gruppen gezählt werden (Ungarn; Rumänen). Was "andere Ethnien" sind, kann also variieren, stillschweigend werden die Lippowaner zu den Russen gezählt und die Székler zu den Ungarn.
Der Anteil der Gruppen an der Gesamtbevölkerung betrug 2011 11,1% (36; aktuell sind es 10,39 %). 20 Gruppen sind 2011 als ethnische Minderheit anerkannt, davon sind 2022 19 im Parlament repräsentiert, wobei Tschangos und Aromunen wie gesagt nicht als ethnische Minderheit anerkannt sind.
Es wird somit beim Einstieg in die Lektüre bereits deutlich, dass "Minderheit" kein fester Begriff sein kann/muss und diese Einsicht bereitet vor auf die folgenden Abschnitte mit der Diskussion von Definitionen von "Minderheit". Kurz gefasst: Es gibt keine einheitliche Definition. Die Autorin zeigt an exemplarischen Ansätzen, dass bereits die Bezeichnung "nationale Minderheit" nicht selbstverständlich ist und in Konkurrenz zu religiösen, sprachlichen, ethnischen und "rassischen" Minderheiten stand. (Der Begriff "rassisch" wurde nach dem Zweiten Weltkrieg weitgehend durch "ethnisch" ersetzt.) Obwohl seit den Konfessionskriegen im 16. Jahrhundert das Problem erkannt wurde, waren es besonders im 19. Jahrhundert die nationalen Bestrebungen, die den Schutz von bestimmten Bevölkerungsgruppen in den neuen Nationalstaaten erforderlich machten. Mit dem Zusammenbruch der Imperien im Ersten Weltkrieg hatten die Pariser Friedensverhandlungen erstmals den Begriff "Minderheit" vielfach verwendet. Auf die dadurch ausgelöste Minderheitendiskussion in Europa mit dem "Europäischen Nationalitätenkongress" geht die Autorin allerdings nicht ausführlicher ein.
Weiterlesen...

"Wie in der Walachei"
Die spannende Geschichte eines sprachlichen Ortes
"Ab in die Walachei" oder "echt walachische Wirtschaft" sind einige der in die deutsche Sprache eingegangenen Sprüche von einer Region, die in diesen Sprüchen nicht bekannt sein muss. Ähnlich wie die einschlägige "Pampa" oder das "böhmische
Dorf" haben diese Bezeichnungen meist eine sehr allgemeine Konnotation, die nichts mehr mit dem topographischen Begriff zu tun hat. "Im deutschen Sprachgebrauch gibt es keine andere konkrete Landschaft, die so mit Bedeutung aufgeladen und - paradoxerweise – von Bedeutung so entleert ist", stellt Ana-Maria Schlupp in ihrer wohlüberlegten Studie fest und geht historisch diesem topos, diesem literarischen Ort nach - von der Antike bis in die Gegenwart. Leitend werden für ihre Untersuchungen von Texten durch die Jahrhunderte 4 Beobachtungen, die bereits in der Antike machen lassen: die Walachei als Ödnis; ihre Bewohner als Barbaren; ihre Lage als Peripherie; ihre Wahrnehmung als Niemandsland und Grenzstreifen.
Dabei ist die Festlegung der walachischen Topographie auf diese Stereotypen sehr früh zu beobachten. Bereits die Antike überlieferte in griechischen und lateinischen Texten die Vorstellung einer wüsten und leeren Landschaft. Ja, in Ovids Texten wiederholt sich eine frühgriechische Rhetorik, die dann über Jahrtausende bis heute die Beschreibung der Landschaft an den Karpaten vorzugeben schien. Sie wird angereichert durch Vorstellungen von nordischen Völkern außerhalb der griechisch-römischen Welt wie den Skythen, Sarmatiern, Geten, Dakern, Thrakern. Jenseits der zugefrorenen Donau scheint im Winter nur eine Eislandschaft zu existieren, die für den Römer Ovid ein unbetretbares Ende der Welt signalisierte. Schlupp kontrastiert gewinnbringend Ovids Klagen und Beschreibungen aus Tomis mit deren Neuaufnahme in Christof Ransmayrs postmodernen Roman "Die andere Welt" (1988).

Der Rumänist Prof. Dr. Heinrich Stiehler
gestorben
In Klosterneuburg bei Wien verstarb am 12. April 2023 der Romanist und Rumänienspezialist Heinrich Stiehler. Der Universitätsprofessor der Wiener Universität war 1948 in Leipzig geboren worden und kam noch vor Errichtung der Mauer nach Frankfurt a.M., wo er 1978 mit einer Arbeit über Panaït Istrati promoviert wurde. Als Hochschullehrer war Stiehler in Frankfurt, Klagenfurt und Wien tätig, mit Gastprofessuren in Iași und Paris.
Stiehler machte durch eine ausführliche Biographie des meist auf Französisch schreibenden rumänischen Autors Panait Istrati auf einen wichtigen Klassiker der rumänischen Kultur aufmerksam, den er insbesondere durch die Herausgabe einer 12-bändigen Übersetzung der Werke Istratis in der Büchergilde Gutenberg im deutschen Sprachraum verankerte. Stiehler war Vize-Präsident der Association des Amis de Panait Istrati.
Aus der rumänischen Literatur des 20. Jahrhundert interessierte Stiehler vor allem auch die Avantgarde, was in Arbeiten über Tristan Tzara, Tudor Arghezi und Paul Celan sich zeigt. Grundlegend ist seine mit dem Jenaer Professor Bochmann geschriebene "Einführung in die rumänische Sprach-und Literaturgeschichte" (Romanistischer Verlag Bonn). Zuletzt erschien eine kurze Darstellung der rumänischen Shoah in der Literatur unter dem Titel „Nacht“ bei der Theodor Kramer Gesellschaft Wien.
Zu Stiehlers 70. Geburtstag widmeten ihm FreundInnen, SchülerInnen und KollegInnen eine umfangreiche Festschrift, die die große Bedeutung des Gelehrten für die Erforschung der rumänischen Kultur und darüber hinaus hervorhob und den großen Verlust für dieses akademisch eher vernachlässigte Feld erkennen lässt. (vgl. auf dieser Website www.kultro.de/wissenschaft [downscroll]).
Die Beerdigung des Gelehrten wird in Rumänien stattfinden.
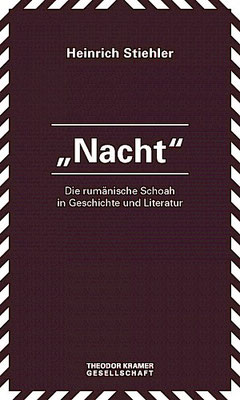
Heinrich Stiehler über die rumänische Schoah
...
Dieser schmale Band ist gewichtig: Durch die originelle Anlage kann der Romanist Heinrich Stiehler ein Bild des rumänischen Holocausts skizzieren, das die wichtigsten Elemente plastisch in den Vordergrund bringt. Einleitend gibt ein knapper Überblick notwendige Informationen zur historischen Entwicklung des Antisemitismus in Rumänien seit dem 19. Jahrhundert. Hier kommen die einschlägigen Texte und Gesetze vor, die im kleinen Königreich hinter den Karpaten gegen die jüdische Bevölkerung veröffentlicht wurden, wobei die Differenzierungen der unterschiedlichen politischen Haltungen ebenfalls aufscheinen. Mit der Vergrößerung Rumäniens nach dem Ersten Weltkrieg erhielt dieser Antisemitismus eine biologistisch-religiöse Note, deren ökonomische Motivierung aber nicht zu übersehen war. Ihre Steigerung führte zur mörderischen Ausrichtung während des Zweiten Weltkriegs, die Stiehler im Hauptteil des Buches durch die Präsentation von literarischen Texten und ihrer Kommentierung vor Augen führt. Dabei geht er topographisch vor: Den zentralen Orten der Shoah ordnet er jeweils 2 Texte zu. Die Situation in Bukarest wird durch einen Ausschnitt aus Filip Brunea-Fox' Reportage Orașul Măcelului über den Pogrom im Zusammenhang mit dem Legionärsaufstand von Januar 1941 sowie durch einen Ausschnitt aus dem Tagebuch des Schriftstellers Mihail Sebastian perspektiviert. In seinen Erläuterungen geht Stiehler sowohl auf die unterschiedlichen literarischen Genres wie auch die konkreten historischen Hintergründe ein. Zu dem Pogrom in Iași wenige Monate später stellt der Rumänist Passagen aus Curzio Malapartes Kaputt und Aurel Barangas Ninge peste Ucraina (Es schneit in der Ukraine) gegenüber, wobei Malaparte sich lediglich als Augenzeuge inszeniert, während Baranga als "sekundärer Zeuge" auftritt, der für die Zeugen spricht - "noch zu deren Lebzeiten und aus Verantwortung für kommende Generationen". (66) Für Czernowitz (Cernăuți) stehen Texte von Isak Weißglas und Robert Flinker. Ersterer berichtet über die zweite Deportationswelle im Sommer 1942, die auch seine Familie betrifft. Flinker schildert in seinem Roman Der Sturz den Aufmarsch eines neuen Präsidenten in einer fiktiven Stadt, die Stiehler als des Autors Heimatstadt Czernowitz in einer Situation der Vorphase des kommenden Unheils interpretiert. Die Deportationen verfrachteten die Czernowitzer und nordmoldauischen Juden nach Transnistrien, dem der Band das Gedicht Krieg der Toten von Weißglas' Sohn Immanuel und einen Ausschnitt aus Edgar Hilsenraths Roman Nacht widmet. Weißglas ruft ein Totenreich auf, in dem die Opfer den Ausbruch des Krieges reflektieren, während Hilsenrath in seinem berühmten Buch schonungslos das Überleben in der Deportation schilderte. Stiehler hebt auch an diesen Beispielen die historischen Hintergründe hervor und diskutiert bei Hilsenrath die literarische Funktion seiner Schonungslosigkeit.
Eine knapper Hinweis auf die Roma in Transnistrien und Kurzbiographien der vorgestellten Autoren schließen den informativen Band ab.
Heinrich Stiehler: "Nacht". Die rumänische Schoah in Geschichte und Literatur. Wien: Theodor Kramer Gesellschaft 2019 (= Antifaschistische Literatur und Exilliteratur - Studien und Texte 31), 131 Seiten, ISBN 978-3-901602-84-9

... und Wissenschaftler zu Heinrich Stiehler
Wer mehr über die Arbeit und das Leben des Autors Stiehler erfahren möchte, wird zu der Festschrift anläßlich seines 70. Geburtstags greifen. Von Carola Heinrich und Thede Kahl herausgegeben versammelt der umfangreiche Band eine Reihe von Beiträgen, die deutlich machen, wie sehr Stiehler einer kritischen Rumänistik zugearbeitet hat. Biographisch ergiebig ist vor allem eine Darstellung aus der Feder des Freundes und Gewerkschaftsdozenten Hans-Rudolf Schiesser über den Weg des Frankfurter Studenten und Wissenschaftlers über Klagenfurt an die Wiener Universität. Im virtuellen Zentrum des Textes steht eine Studienfahrt mit Stiehler durch Rumänien im September 1989(!!). Der Bukarester emeritierte Philologe Mircea Martin erinnert an frühe Begegnungen mit Stiehler, während Christian Delrue von der französischen Gesellschaft der Freunde Panait Istratis deren Vizevorsitzenden grüßt. Zentral im Werk Stiehlers steht die Beschäftigung mit dem vor allem auf Französisch schreibenden rumänischen Autor Panait Istrati, dem die Habilschrift wie auch eine 14-bändige deutsche Ausgabe galt. Zu Istrati handeln in dem Sammelband auch Zamfir Bălan mit unedierten Briefen an Mihai Sadoveanu und Serguei Feodossiev mit Texten über Istrati aus der russischen Exilzeitschrift Vozrojdenie.
In ihrem Aufsatz zur Rumänisierung in der Bukowina nach dem Ersten Weltkrieg weist Mariana Hausleitner darauf hin, dass Stiehler auch einer der ersten war, der die Lyrik Paul Celans in der deutschsprachigen jüdischen Kultur von Czernowitz verortete. Klaus Bochmann und Wolfgang Dahmen geben in Übersichtsartikeln Einsicht in die Entwicklungen der rumänischen Linguistik bzw. in die nicht sehr angemessen repräsentierte Rumänistik in Deutschland und der Schweiz. Mit Bochmann hat Stiehler eine Einführung in die rumänische Sprach- und Literaturgeschichte (Bonn 2010) geschrieben. Abgeschlossen werden die durch Farbfotos ergänzten Bezugnahmen auf seine Arbeiten durch "Literarische Grüße" von Liviu Papadima, Ioana Nichiti und Constantin Abăluță.
Die weiteren Arbeiten der Festschrift widmen sich in 4 Abschnitten den Hauptarbeitsgebieten Stiehlers: der rumänischen, der französischen und der deutschen Literatur sowie der Mehrsprachigkeit. Im rumänischen Teil gehen Aurelia Merlan und Anke Pfeifer der Semantik der Donau in Sprache und Farbe nach: bei Merlan ist es die signifikante Herausstellung des Flusses als Grenze und ihre Verstärkung in der volkstümlichen Liedkultur, bei Pfeifer in der Farblichkeit von Blau bis Schwarz in Musik und Film. Etwas verkürzt ist Mit-Herausgeberin Carola Heinrichs Auseinandersetzung mit postsowjetischen Erinnerungskulturen, da sie nur Horațiu Mălăeles Film Nuntă mută und Vasile Ernus Buch Născut în USSR als rumänische und moldauische Beispiele heranzieht. Sehr konzise und informativ hingegen Anton Sterblings Beitrag über das Bild des Intellektuellen in Rumänien und im Westen auf der Basis klarer Differenzierungen und illustrierender Beispiele. Ebenfalls sehr reflexiv und aufmerksam Ilina Gregoris Umgang mit Emil Ciorans später Hinwendung zu Biographik und dem Lob in einzelnen Porträts. Durch Ciorans Beispiel inauguriert wenden sich die beiden weiteren Beiträge rumänischen Autoren zu, die gänzlich oder in Teilen sich der französischen Literatur zuwandten: Christina Vogel zeigt Benjamin Wechsler (Fundoianu; Fondane) in seiner Abwendung von allen Traditionalismen (Judentum, rumänische Sprache, moldauische Avantgarde) und Hinwendung zu einem philosophischen Existenzialismus der Freiheit; Florin Oprescu geht Gherasim Lucas Entwicklung zwischen Marxismus und Surrealismus nach - bis zu dessen Freitod 1994 in der Seine, 24 Jahre nach dem von Paul Celan.
So vorbereitet schließt sich ein französisches Kapitel an mit Untersuchungen zum okzitanisch-rumänischen Verhältnis, zur deutsch/französisch-rumänischen Beziehung und Michelets Blick auf den Osten. Gleich der erste Beitrag von Georg Kremnitz hält eine überraschende Perspektive auf die in rumänischen Literaturgeschichten gerne erwähnte Verleihung eines lateinischen Preises an den Klassiker Vasile Alecsandri 1878 in Toulouse bereit. Kremnitz stellt die idée latine in Okzitanien in ihren Kontakten mit dem aufstrebenden Rumänischen nach der Mitte des 19. Jahrhunderts dar und kann so die oft unvermittelt erscheinende Preisverleihung an Alecsandri in den Kontext der Selbstbewusstwerdung von Minderheitensprachen verorten. In der Epoche von Alecsandri erreichte der französische Einfluss einen Höhepunkt, wie Marina Mureano Ionescu in ihrem Überblicksartikel zeigt. Ihr Aufsatz reicht bis in die französische Kulturpräsenz im kommunistischen Rumänien und illustriert mit Beispielen vor allem aus Iași, wie Rumänien zu einem frankophonen Land wurde. Umgekehrt hat der Historiker Jules Michelet im 19. Jahrhundert das Bild Osteuropas und Rumäniens als "Norden" geprägt und Rumänien in Beziehung zur "Weiblichkeit" Frankreichs gesetzt - diese überraschenden Imaginationen des Nationalcharakters skizziert Fritz Peter Kirsch.
Die Abteilung zur deutschen Literatur eröffnet Ioana Crăciun mit einem präzisen Aufsatz zur Verfilmung des Romans "Frau im Mond" des zeitweiligen Ehepaars Thea von Harbou / Fritz Lang: Sie schrieb das Buch, er machte 1929 den Film daraus; sie verfuhr mit einer Art Mythencollage bei dem technisch-fantastischen Thema, er reduzierte das Geschehen auf technische Vorgänge. Die Heldin wird zur "Bubikopf-Emanze" der 1920er Jahre. Crăciun geht sehr intensiv auf die Geschlechter- und Mythenklischees von Buch und Film ein. Wie sich die Lage von ÜbersetzerInnen in jener Zeit veränderte, untersucht Larissa Schippel am Beispiel der durch die Nazis verbrannten Werke und kann zeigen, wie sich das Los der ÜbersetzerInnen durch die Nationalsozialisten verschlechterte. Nicht wenige wurden nach der Verbrennung ihrer Übersetzungen bei den Bücherverbrennungen in Hitlerdeutschland und Österreich ins Exil gezwungen, wo sie mitunter - wie Lucy von Jacobi in der Schweiz - nur unter Pseudonym weiter arbeiten konnten. Ein aufschlussreicher Zugang zu den translation studies. Die Temeswarer Übersetzerin und Theaterspezialistin Eleonora Pascu übertrug Thomas Bernhards Immanuel Kant (1978) und bietet neben einer präzisen Analyse der Bernhardschen Machart einen Bericht über ihre Übersetzung für das Temeswarer Teatru de Vest, das 2011 unter der Regie von Alexandru Colpaci das Stück auf die Bühne brachte. Die Übersetzung wurde auch in einem Verlag veröffentlicht.
Eine Reihe von Texten widmen sich der Mehrsprachigkeit, zu der Stiehler ebenfalls mehrfach publizierte. Sie führen zunächst nach Lateinamerika, wo Karsten Garscha am Beispiel von Alejo Carpentier, Jorge Galán und José Maria Arguedas die drei zentralen Reaktionen der mittel-und südamerikanischen Literatur auf den Einfluss der europäischen und afrikanischen Kultur erkennt: Kulturmischung (mestizaje cultural) im Roman Barock-Konzert (1974) von Alejo Carpentier, kulturelle Heterogenität bei Arguedas' Roman Die tiefen Flüsse (1958) und Transkulturalität bei Jorge Galáns Mein dunkles Herz (2013). Garscha geht es um die Herausarbeitung präziserer Begriffe als dem des oft verwendeten des "magischen Realismus". Diese Literatur reagiert auf globale Migrationsphänomene, die an einem afrikanischen Beispiel der Cineastik Doris Posch untersucht. In der durch die aktuell en vogue flottierenden Begriffe postkolonialistischer Theoriebildung fast verdeckten eindringlichen Analyse wird das Verhältnis der senegalesischen Filme Milles Soleils (2013 ) und Touki Bouki (1973) zueinander in zahlreichen Facetten der postkolonialen Erinnerungskultur erörtert - von der politischen Geschichte des Senegal über ästhetische Verfahren bis zu den Verwandtschaftsverhältnissen der Regisseurin Mati Diop zu dem Regisseur Djibril Diop Mambéty. Es eröffnet sich ein Panorama der postmodernen/-kolonialen Bedeutungsmigration, das um das Thema des realen Aufbruchs der afrikanischen Jugend nach Europa und das nicht gelebte Leben kreist - offensichtlich ein spannendes Verhältnis, unterlegt mit Tex Ritters Eröffnungssong aus High Noon! Stranden viele der aus Afrika nach Europa aufbrechenden Menschen an der geologischen Grenze - am Mittelmeer - so haben die spanischen Enklaven Ceuta und Melilla eine besondere Anziehungskraft, da sie bereits europäisches "Territorium" darstellen. Wie diese "spanischen" Städte sich in Marokko gegen Rückgabeforderungen verschanzen, machen die Beobachtungen von Peter Cichon anlässlich zweier Studienreisen mit Wiener RomanistInnen deutlich, wonach die große arabischsprachige Bevölkerung hohe Schulabbrecherquoten aufweist, weil die Aufrechterhaltung der kolonialen Situation der espaniadad das Festhalten an der offiziellen Einsprachigkeit erfordert. Die arabische Sprache der muslimischen Bevölkerung (wie auch der Berber) darf daher in der Schule nicht unterrichtet werden. Sprachlich angepasst haben sich die sehr kleinen Communities der jüdisch-hebräisch und der indisch-hinduistischen(!) Gläubigen. Allerdings kommen die afrikanischen Migranten an den die Enklaven abgrenzenden Zäunen in dem Beitrag nicht vor.
Nach Amerika, Afrika und Europa kommt auch Asien explizit in den Fokus: Alexandru Cizek und Thede Kahl bewegen sich mit ihren Aufsätzen im Übergangsfeld von Griechenland und der Türkei - Ursprungsterritorien des europäischen Denkens. Welche unübersehbaren Parallelen zwischen der aktuellen Migrationslage und der vor 2500 Jahren von Homer in der Odyssee geschilderten sich ausmachen lassen, verfolgt Cizek in seinem Text zu Odysseus, dem Symbol des Migranten schlechthin. Dabei kommt auch die eigene Migrationsgeschichte der Familie aus dem Altreich Rumäniens in den Westen wie auch die unbekannt gebliebene Geschichte der zahlreichen Opfer von Fluchtversuchen aus dem kommunistischen Rumänien an Donau und Schwarzem Meer (!) zur Sprache. Mitherausgeber Thede Kahl schließt den wissenschaftlichen Teil mit einer Übersicht über die Gräzisierung des ursprünglich osmanischen Schattentheaters Karagöz ab. Dieses auf Jahrhunderte alte Vorbilder aus Asien und dem Nahen Osten zurück gehende volkstümliche Schattenspiel taucht in der Mitte des 19. Jahrhunderts in griechischen Versionen auf, deren Adaptionen an die lokalen Verhältnisse dafür sorgten, dass die Variante als einzige neben den osmanischen Formen überlebte. Die ursprünglich sehr obszönen Stücke erfuhren im Laufe ihrer Gräzisierung eine Erweiterung der Personen und auch Schauplätze. Hervorzuheben ist auch ihre sprachliche Vielfalt mit Einsprengseln des Persischen und Arabischen.
Die zahlreichen diversen Beiträge belegen, wie sehr die von Heinrich Stiehler beackerten wissenschaftlichen Felder Rumänisch in einen weiten Kontext stellen können und wie sehr anschlussfähig das Werk des Rumänisten Heinrich Stiehler für viele Themen ist. Dem so Geehrten und der Rumänistik bleibt zu wünschen, dass seine Arbeiten weiterhin das Projekt einer kritischen Rumänistik fortschreiben.
Carola Heinrich / Thede Kahl (Hg.): Litterae - magistra vitae. Heinrich Stiehler zum 70. Geburtstag. Berlin: Frank & Timme 2018 (Forum: Rumänien 38), 498 Seiten, ISBN 978-3-7329-0464-8, zahlr. Farbabb.

Philologie des Rumänischen
Zu den literaturwissenschaftlichen Arbeiten von Ilina Gregori
1986 erhielt die Literaturwissenschaftlerin Ilina Gregori Post aus Paris: Der Begründer des absurden Theaters, Eugène Ionesco bat sie, ihren raffiniert originellen Aufsatz zu Eugen Ionescus rumänischem Essayband Nu (1934) als Nachwort für die französische Ausgabe freizugeben - ein Beispiel der Aufmerksamkeit für die Arbeiten der seinerzeit an der Freien Universität Berlin lehrenden Philologin, wie sie nur wenige LiteraturwissenschaftlerInnen erfahren. Der Aufsatz zu Ionescus Nu lässt sich in einer Sammlung von philologischen Beiträgen Gregoris nachlesen, die 2010 im renommierten Heidelberger Universitätsverlag Winter erschien. Können unter der Rubrik Romanistik bei dem wissenschaftlichen Verlag 280 Titel aufgerufen werden, so finden sich darunter allerdings nur 4 Bücher, die sich rumänischen Themen widmen, erschienen in dem schmalen Zeitfenster 2005-2007. (Keine ganz zufällige Spiegelung jener unerklärlichen Vernachlässigung, der die von über 20 Millionen SprecherInnen benutzte Sprache und zugehörige Literatur innerhalb der großen akademischen Romanistik anheim fällt.) Als eines dieser vier Bücher stellt Gregoris Aufsatzsammlung ein Musterbeispiel dessen dar, was und wie die rumänische Literatur und Sprache Gegenstand innovativer, akribischer Forschung sein kann. Die Autorin untersucht in den Aufsätzen, deren Erscheinungsdaten von 1980 bis 2005 reichen, mit einem variierten theoretischen Instrumentarium Texte von Eminescu über Caragiale (Vater und Sohn), das Dreigestirn Eliade, Cioran, Ionescu, die Surrealisten und die Nachkriegsliteratur bis zu Mircea Cărtărescu - Forschungen, die insbesondere eine Frucht ihrer 3 Dezennien währenden Forschungs- und Lehrtätigkeit an der Freien Universität Berlin sind.
In den akribisch recherchierten, oft auf Französisch formulierten Fallstudien des Sammelbandes finden sich bereits einige der Themenfelder Gregoris wieder, denen sie vor und nach dem Sammelband mehrere Monographien widmete. So vertieften 2008 ihre kritischen Studien Stim noi cine a fost Eminescu? Fapte, enigme, ipoteze (Wissen wir, wer Eminescu war? Fakten, Rätsel, Hypothesen, 2008) die Berlin- und Schopenhauer-Aspekte des rumänischen "Nationaldichters" und gingen detailliert auf Eminescus Berliner Jahre als Sekretär der rumänischen Gesandtschaft ein. An der Spree schrieb Eminescu aus Interesse an den Berliner Ägyptischen Sammlungen etwa jene Fragmente Avatarii faraonului Tlà (Die Wiederverkörperungen des Pharaonen Tlà), die von ihrem späteren Entdecker, dem Literaturwissenschaftler George Călinescu, 1932 als eine Art metaphysische Novelle zusammengestellt und mit dem bis heute verwendeten Titel versehen wurden.

In diesem unvollendeten Text sah Călinescu eine Darstellung der von Schopenhauer unter Einfluss asiatischer Philosophie propagierten Metempsychose – dem Weiterleben der Seele in verschiedenen Körpern, hier von dem ägyptischen Pharaonen Tlà über den mittelalterlichen Bettler Baltazar und den Marquis Alvarez hin zum moldauischen Iorgu im Iaşi des 19. Jahrhunderts. Gregori kann durch Kritik an den bisherigen Eminescu-Ausgaben diese Interpretation in Frage stellen, ihr Ansatz weist auf die Frage der Identität hin, die Eminescu quälte und nicht mit der Schopenhauerschen Metempsychose zu verwechseln sei. Vorbilder könnten in Edgar Allan Poes oder Théophile Gautiers phantastischen Erzählungen erkannt werden. Zudem zeigt die Autorin detailliert den Hintergrund der Berliner Ägyptologie mit ihrem weltweit anerkannten Nestor Richard Lepsius als Direktor des Ägyptischen Museums, das Eminescu zum Ort der Anregung für das Konvolut wurde. Gregoris innovative Eminescu-Studien wurden mit dem Preis des Rumänischen Schriftstellerverbandes ausgezeichnet.

Dass diese phantastische Erzählung ihre auch psychologischen Konnotationen zu erkennen gibt, geht auf Gregoris monographische Beschäftigung mit der Literatur des Phantastischen zurück, ein Genre, das in Rumänien auf besonderes Interesse und nicht wenige Adepten gestoßen ist. Gregori widmet ihre Studie "Singura literatură esențială". Povestirea fantastică (1996) allerdings, wie der Untertitel aufzählt Balzac, Villiers-de L'Isle-Adam und Pieyre de Mandiargues. In der französischen Phantastik des 19. Jahrhunderts, die in der Auseinandersetzung von Aufklärung, Romantik, Industrialisierung und Rationalismus entsteht, erkennt die Autorin in ihrer präzise dargestellten Unterfütterung des "Unheimlichen" und Phantastischen die psychologische Dimension der von Siegmund Freud entworfenen, auch erotisch konnotierten Funktion des "Unterbewussten". In der Folge wird das Interesse am Traum deutlich hervorgehoben, wie es auch bei Eminescu produktiv wurde. Onirische Phänomene weisen zudem auch in Richtung des rumänischen Surrealismus und seiner französischen Vorbilder.

Dass Gregori ein besonderes Interesse an daseinsanalytischen
Theorien und Darstellungen zeigt, ist auch an ihrer 1977 bei dem Aachener Philosophen Walter Biemel (1918-2015) entstandenen Dissertation mit dem Titel Merleau-Pontys Phänomenologie der
Sprache abzulesen. (Biemel wurde in Topčider b. Belgrad geboren und wuchs in Braşov/Kronstadt auf. Er machte sich bereits in den 1940er Jahren um die Husserl- und Heidegger-Forschung als Herausgeber
verdient. Nach der Übersiedlung in die BRD lehrte er an der RWTH Aachen.) Der Existenzialismus Heideggerscher bis Sartrescher Prägung führte im 20. Jahrhundert eine weitere Variante
des Seindenkens ein, die auch auf einen rumänischen Autor verweist, der auf Französisch reussierte und im Bann der Reflexion des Daseins stand: Emil Cioran. Gregori widmet ihm eine ingeniöse
Studie, die anhand von dessen auf den ersten Blick erstaunlichen Buch Exercices d'admiration Vorschläge für eine "unmögliche Biographie" macht. Ausgehend von Ciorans (ironischem?)
Diktum, dass die Möglichkeit, dass jemand Gegenstand einer Biographie werden könnte, noch niemanden davon abgehalten habe, sein Leben zu leben, untersucht Gregori die ambivalenten
Bewunderungsgesten Ciorans in dem zu seiner eigenen Überraschung erfolgreichsten Buch, das er im Alter von 75 Jahren veröffentlichte. Entgegen der häufigen Marginalisierung dieser "Übungen im
Bewundern" kann Gregori die enorme Bedeutung der Textsammlung für die Themenkomplexe Fragmentarismus der Identität, Individuum und Selbstperspektive herausarbeiten. Cioran erscheint als Frager
nach dem "Ich" und "Du" und kann sich der Erkenntnis nur öffnen, wenn ihn wie ein Moment der Eingebung oder Erleuchtung eine "Demut" (ingenunchare) ergreift. Jenseits der Porträts von
Fitzgerald bis Beckett greift Gregori auch auf einen frühen Text Ciorans zurück, der den rumänischen Faschistenführer Codreanu verherrlichte, und setzt ihn mit überraschenden Einblicken in
Ciorans Entwicklung in Beziehung zur späteren Porträtistik. Im zweiten Teil des Bandes geht die Autorin Ciorans kaum wahrgenommenem Text Paléontologie nach - dem Resultat eines
'ungeplanten' Besuchs im anthropologischen Museum mit seinen Skeletten und Präparaten wie auf einem Friedhof. Cioran verweist in monastischer Tradition auf das "Glück der Knochen" nach dem
Verlust des sündenvollen und leidbringenden Fleisches. Ein Porträt eigener Art des Menschen in seiner Evolution! Gregoris Buch vermittelt mit einer Fülle ebenso unerwarteteter wie
anregungsreicher Beobachtungen an den Texten Ciorans, die u.a. wie bei Eminescu auf den Buddhismus und Schopenhauer verweisen, was Präzision und Phantasie der Philologie an Einsichten und
Verständnis aus zunächst nicht leicht verständlichen Texten hervorholen können.

Ende Februar 1966 widmete Cioran nur im Vorbeigehen in seinen außerordentlichen Cahiers (dt. Notizen. Klagenfurt 2011) die Reminiszenz einer Begegnung in einem Londoner Altersheim mit dem gealterten und verarmten Matila Ghyka. Ansonsten war dieser Solitär der europäischen Kultur auch in Rumänien fast vollständig vergessen, bevor Ilina Gregori tatkräftig an seiner Wiederentdeckung mitgewirkt hat. In mehreren Zeitschriftenbeiträgen und Aufsätzen (darunter in dem Sammelband "Vergessen, verdrängt, verschwunden" der deutschen Balkanromanisten) ließ sie ihre Forschungen zu dem Mathematiker, Schriftsteller, Philosophen, Ästhetiker, Übersetzer, Seeoffizier erscheinen, bevor ein eigenes Buch umfassende Aufschlüsse über den Nachfahren der alten Bojarenfamilie Ghyka gibt. Es entstand dabei ein faszinierendes Kaleidoskop an Perspektiven auf diese polyhistorische europäische Gestalt des 20. Jahrhunderts. Auch hier sind es nicht zuletzt Fragen der biographischen Porträtierung, die Gregori unterschiedlichste Felder betreten lassen. Weit davon entfernt eine runde Biographie liefern zu wollen, sind es die ebenso sensiblen wie hartnäckigen Fragen an die Quellen, die plastisch das Beispiel eines uomo universale aus längst vergangenen Zeiten entstehen lassen. Ghyka erwarb sich in den 1920er Jahren innerhalb kurzer Zeit höchstes Ansehen in der elitären Pariser Intelligenz, als er ein Buch über ästhetische Formen in Natur und Kunst (Esthétique des proportions dans la nature et dans les arts, Paris 1927) publizierte, dem sein zweibändiges Hauptwerk Le Nombre d'Or (1. Les rhytmes, 2. Les rites) über die faszinierende Kulturgeschichte des Goldenen Schnitts 1931 im angesehenen Verlag Gallimard folgte - von einem lobenden Vorwort seines Freundes Paul Valéry begleitet, der damals - wie Gregori überzeugend skizziert - als wichtigster Intellektueller des Landes galt. Beide vereinte das Interesse an einer rationalen Begründung von Ästhetik, die Ghyka als Mathematiker auf antik griechische Modelle der "heiligen Zahl" zurückführte. In der beispiellosen Krise der europäischen Kultur nach dem Ersten Weltkrieg sollten noch einmal Schönheit der Wissenschaft und Wissenschaft des Schönen ineinander verwoben werden. In Deutschland wurde Ghykas Buch in der Ausstellung Göttlich Golden Genial (Berlin 2017, Frankfurt 2018) über die Kulturgeschichte des Goldenen Schnitts passager wahrgenommen, eine Übersetzung seines Hauptwerks liegt bisher nicht vor. Eingehend widmet sich Gregori auch Ghykas Roman Pluie d'Étoiles (Paris: Gallimard 1933), dem einzigen belletristischen Werk des Ästhetikers und Mathematikers, das dessen Denken zwischen Zahl und Wort in ein besonderes Licht stellt. Es wäre zu wünschen, dass Gregoris Forschungen diese vergessene rumänische Gestalt der europäischen und amerikanischen Kultur des 20. Jahrhunderts auch in Deutschland in ihren unzähligen Facetten und Wirkungen (etwa auf Salvador Dáli, Peter Brook, Le Corbusier, Leigh Fermor u.a.) lebendig machen könnten.
Nicht nur in diesem Fall, verdeutlicht der selbst nur kursorische Blick auf die Arbeiten von Ilina Gregori einmal mehr, wie sehr die Arbeit an der rumänischen Geistesgeschichte ein integraler und unverzichtbarer Teil der europäischen Kultur darstellt.
Zum 100. Jahrestag der Vereinigung Rumäniens erhielt Gregori 2018 mit 10 weiteren VertreterInnen der Diaspora den Preis Euro Centenart des Muzeul Național al Literaturii Române. 2020 wurde der auch als Übersetzerin hervorgetretenen Autorin für ihre Arbeiten vom rumänischen Präsidenten der Orden Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler verliehen.
Rumänistische Literaturwissenschaft. Fallstudien zum 19. und 20. Jahrhundert. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2007, 331 Seiten, ISBN 978-3-8253-5260-8
Merleau-Pontys Phänomenologie der
Sprache. Diss. Aachen 1977
"Singura literatură esenţial ". Povestirea Fantastica. Balzac, Villiers-de L'Isle-Adam, Pieyre de Mandiargues. ["Die einzige wichtige Literatur". Phantastisches Erzählen] Editura DU Style, Bukarest 1996, 239 Seiten, ISBN 973-9246-00-1
Știm noi cine a fost Eminescu? Fapte, enigme, ipoteze. [Wissen wir, wer Eminescu war? Fakten, Rätsel, Hypothesen] Editura ART, Bukarest 2008, (Colecţia Revizitări ), 331 Seiten, mehrere Abb., ISBN 978-973-124-188-3
Cioran. Sugestii pentru o biografie imposibilă. [Vorschläge für eine unmögliche Biographie]Editura Humanitas, Bukarest 2012, 241 Seiten, mehrere Abb., ISBN 978-973-50-3760-4
Păstrat în uitare? Matila Ghyka. Numărul şi Verbul. [Aufbewahrt im Vergessen? M.G. Die Zahl und das Wort] Editura Tracus Arte, Bukarest 2018, 361 Seiten, mehrere Abb., ISBN 978-606-664-965-0

Loyalität der Minderheiten in der Republik Moldova
Rosanna Doms Dissertation über die Stimmung der ukrainischen und russischen Minderheit
Die besondere geopolitische und historische Lage der Republik Moldau erregt immer wieder erneutes Inter-esse an ihrer politischen Struktur und Entwicklung und den Handlungsmotiven ihrer politischen Eliten. Eines der dabei aufscheinenden Themen ist die Frage nach dem Anteil der russischen und ukrainischen Minderheit und ihren Orientierungen in einem sich nach innen und außen oft als "rumänisches" Land darstellenden Staat. Dieser Problematik geht die Dissertation von Rosanna Dom nach, die 2015 an der Universität Regensburg angenommen wurde.
Am Beginn der umfangreichen Einleitung steht ein Interview mit einer Bewohnerin Moldaus, das die Diskrepanzen deutlich aufzeigt. Die Frau sagt:
"wir sind in Moldawien geboren, wir sind der Nationalität nach Ukrainer, aber unsere eigene Heimat - wir haben - //äh// zumindest gegenwärtig keine. [...] ich bin eine Russischsprachige, aber eine Moldawierin. Aber jetzt bin ich keine Moldawierin mehr, weil es Moldawier nicht mehr gibt. Bei uns sagen alle, dass wir Rumänen sind, Rumänisch //äh// alles Rumänische ist, obwohl das gemein ist, sehr gemein, sehr gemein. Mich schmerzt das sehr." (19)
Die Interviewte gibt dann noch ein Beispiel, wonach ein ('rumänischer') Verwandter ihres Ehemannes sich sehr überheblich gegenüber Ukrainern zeigte. Die Autorin hat zahlreiche solcher Interviews mit Angehörigen der ukrainischen und russischen Minderheit in der Republik Moldau geführt, um deren Ansichten und Gefühlslagen genauer kennenzulernen.
Dom beginnt allerdings ihre Darstellung mit einer umfangreichen Einführung (19-91) in die politische und historische Situation der Moldau seit den späten 1980er Jahren, in der insbesondere die Veränderung der Position von Russen und Nicht-Russen in dem entstehenden neuen Staat skizziert wird. Zentrale These ist dabei, dass mit dem Prozess der Auflösung der Sowjetunion und dem Aufkommen der Unabhängigkeitsbewegung in der Moldau eine "Statusinversion" einherging, die aus den bisher dominierenden Russen eine Minderheit machte und die bis dahin eher marginalisierten Moldauer ("Rumänen") in den Vorgrund schob. Letztere organisierten sich als "Volksfront" (Frontul Popular) und erreichten noch vor der Unabhängigkeit die Mehrheit im regionalen Parlament. Dort erließen sie weitreichende Sprachengesetze, die Rumänisch zur Staatssprache und die lateinische Schrift für verbindlich erklärten. Damit waren für nur Russischsprechende erhebliche Nachteile auf dem Arbeitsmarkt verbunden. Die Autorin weist zudem auf langwährende Debatten über das Eigen-verständnis des neuen Staates in Beziehung zur russischen Politik und vor allem in Abgrenzung von der früheren Autonomie im sowjetischen Imperium hin. So gibt es eine "rumänistische" Position, wonach die Republik Moldau überwiegend aus der Nähe zum EU-Staat Rumänien sich definiere, während eine "moldovanistische" mehr auf die Eigenständigkeit und/oder auf die sowjetische Vergangenheit abhebt und den neuen Staat als zur Einflusssphäre Russlands gehörig sieht.
Aus ihren 32 Interviews generiert Dom 3 zentrale Typen von Trägern bestimmter Haltungen in den russischen und ukrainischen Minderheit hinsichtlich der Loyalität gegenüber dem neuen Staat:
"Anhänger einer sowjetischen Ordnung",
"Verfechter einer russischen Welt"
und "Integrierer" (80-94).
Letztere sind in der Lage, die Moldauer ("Rumänen") als Teil der veränderten Gesellschaft ohne Ängste oder Vorurteile wahrzunehmen und mit ihnen zu kommunizieren, d.h. sie sprechen auch Rumänisch. Erstere erinnern sich gern an "die Ordnung" der Sowjetzeit, an die "Völkerfreundschaft" als Gegenentwurf zur Ethnisierung, die sie gern auch im neuen Staat verwirklicht sehen würden. Der Typus "Verfechter einer russischen Welt" wird von Interviewten repräsentiert, die eine mögliche Vereinigung der Republik Moldau mit Rumänien fürchten, da ihrer Vorstellung nach daraus die Vertreibung der Vertreter der russischen und ukrainischen Minderheit resultieren würde. Die "Verfechter einer russischen Welt" rekurrieren vor allem auf historische Situationen wie die Zwischenkriegszeit oder den Zweiten Weltkrieg und sehen in dem abtrünnigen "Transnistrien" eine interessante Alternative zur Republik Moldau. Ebenso resultieren aus den unterschiedlichen Typen unterschiedliche Haltungen gegenüber der EU, Russland und Transnistrien (Pridnestrowskaja Moldavskaja Respublika; PMR).

Wo finde ich was?
Rumänische Archive zur Geschichte der Deutschen
Wer etwas über die Geschichte der deutschen Minderheiten in Rumänien erfahren möchte, wird in Rumänien zunächst im System der Staatsarchive zu suchen beginnen. In den Kreisdienststellen des Nationalarchivs (Servicii Județene ale Arhivele Naționale ale România) werden historische Dokumente gesammelt und aufbewahrt. Wenn es um die deutschen Minderheiten im Westen des Landes geht, halten in deren Siedlungsgebieten die Kreisdienststellen Material vor, da nach 1918 die früheren österreichisch-ungarischen Archive in dieses rumänische System eingepflegt wurden. Für die weitgehend geschlossenen Siedlungsgebiete der deutschen Minderheiten also vor allem in den Kreisen Cluj, Sibiu, Brașov, Timișoara, Satmar, Caransebeș sind daher in den staatlichen Archiven durchaus umfangreiche Bestände zu finden.
Wie die Germanistin Michaela Nowotnick durch ihre wissenschaftlichen Recherchen in Siebenbürgen erfuhr, hat sich zudem innerhalb der Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen eine große Menge an Archivmaterial erhalten, das nicht in den staatlichen Archiven sich findet: in Familien, Institutionen, Behörden, Kirchen, u.a. Der Zustand dieses Materials ist nicht zuletzt durch die Vernachlässigung infolge der Ausreise der meisten Sachsen nach Deutschland immer prekärer geworden. Es fehlt die interessierte Trägergemeinschaft, die das Material übernehmen und sichern könnte. Hier droht einzigartiges historisches Material allmählich zu verschwinden. Auf der Basis eines von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien geförderten Forschungsprojekts hat Nowotnick 2016 - 2017 ein Projekt zur Erfassung und Notsicherung solchen Materials durchgeführt.
In zwei Ausgaben der Zeitschrift Spiegelungen des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte in Südosteuropa (IKGS) in München veröffentlichte die Literaturwissenschaftlerin nun als weiteres Ergebnis ihrer Arbeit knappe, meist von den leitenden MitarbeiterInnen der Archive verfasste Übersichtsbeiträge zu den Archiven in Rumänien, die nicht nur deutlich machen, was es an Archivmaterial gibt, sondern auch welche Anstrengungen an Recherche zu weiteren Archivquellen, zur Sicherung und Erhaltung notwendig sind. Nach Kreisen geordnet werden diverse Archive vorgestellt. Zunächst die Regionalstellen des Nationalarchivs in Sibiu, Cluj, Brașov, Alba Iulia und Mureș. Darüber hinaus wird auf das Zentralarchiv der Evangelischen Kirche, darin die Transsylvania-Bibliothek der Evangelischen Kirche und die Friedrich Schuller-Schulbuchsammlung in Sibiu eingegangen; in Brașov auf Archiv und Bibliothek der Honterusgemeinde.
Jenseits davon beschäftigt sich das New Yorker Leo-Baeck-Institut mit Dokumenten der jüdischen Gemeinden in Siebenbürgen, während zum Siebenbürgisch-Sächsischen Wörterbuch Sigrid Haldenwang eine ausführliche Darstellung der Geschichte und Quellen gibt. Spuren des Jiddischen Theaters in den Archiven geht Corina L. Petrescu nach und Corneliu Pintilescu stellt das Saxonica-Projekt zur Alltagsgeschichte der Siebenbürger Sachsen vor.
Im zweiten Band geraten neben den reichhaltigen Kreisdienststellen des Nationalarchivs in Temeswar und Karansebeș sowie in Craiova vor allem weniger bekannte Archive und Sammlungen in den Fokus. So werden Quellen zur Geschichte der Deutschen in der Dobrudscha, in Bukarest, der Zipser Schulgeschichte, der Sathmarer Diözese, das Projekt Wörterbuch der Banater deutschen Mundarten oder das Archiv der Fotos von Eduard Höfer für die Allgemeine Deutsche Zeitung vorgestellt. Querschnitte gehen auf einzelne Forschungsgebiete ein. So gibt die Historikerin Marina Hausleitner einen Einblick in ihre jahrzehntelange Arbeit in rumänischen, ukrainischen und moldauischen Archive zu den deutschsprachigen Minderheiten, der u.a. erkennen lässt, weshalb bestimmte Quellen überliefert werden und andere nicht. Laura G. Laza stellt mit Blick auf deutsche Schriftsteller den CNSAS als Archiv der früheren Geheimdienste und der Securitate vor. Auf Musiksammlungen geht Franz Metz ein, das Archivgut zum deutschen Theater in Siebenbürgen und im Banat stellt Ursula Wittstock vor. Erwin Josef Țigla macht auf die Literatursammlungen des Alexander Tietz-Hauses in Reschitza aufmerksam, in denen zahlreiche Aspekte der Geschichte und Kultur der Berglanddeutschen des Banat gesammelt werden.
Alle diese Beiträge lassen erkennen, welche Chancen für die Forschung noch in den rumänischen Archiven mit Bezügen zur deutschsprachigen Kultur liegen und zu ergreifen sind. Darüberhinaus wird klar, dass die noch nicht in Archiven gesicherten Dokumente und Quellen dringend der Sichtung und Sicherung bedürfen. Die beiden Hefte der Spiegelungen sind ein animierendes und ermutigendes Beispiel für die Beschäftigung mit den überlieferten Quellen der Deutschen in Rumänien.
Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas
Heft 1/2018, Jg. 13 (67) Archive in Rumänien (I)
Heft 2/2018, Jg. 13 (67) Archive in Rumänien (II)
Verlag Friedrich Pustet, Regensburg

Katharina Biegger
New Europe College, Bukarest,
1994 bis 2019 – und weiter!
Foto: NEC
Als Institute for Advanced Study in den Geistes- und Sozialwissenschaften unterstützt das New Europe College in Bukarest seit nun über 25 Jahren besonders talentierte Forscherinnen und Forscher, hauptsächlich aus Rumänien und den angrenzenden Ländern, aber auch weltweit: Sie können sich bewerben um Fellowships von ein oder zwei Semestern. Die Nachfrage ist groß, die Auswahl der jährlich rund 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch den internationalen Beirat streng. Das NEC unterstützt nicht allein finanziell, sondern bietet zugleich eine gute Infrastruktur und ermöglicht die Konzentration auf die Forschung. Es befördert zwanglos die Internationalisierung und setzt hohe Maßstäbe, da sich die Stipendiaten Seite an Seite mit ausgesuchten Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern und anderen Disziplinen finden. So werden Denkroutinen gelöst und ein Ambiente geschaffen, von dem man sich eine kritische Infragestellung und Bereicherung der Arbeit der Einzelnen erhoffen kann. So die Kurzbeschreibung für den heutigen Zustand.
Als das New Europe College (NEC) in den frühen 90er Jahren erdacht und schließlich am 26. Januar 1994 als ‚Persönlichkeit‘ nach rumänischem Recht institutionalisiert wurde, nahm sich das alles bescheidener, vorläufiger aus – und doch war der Kerngedanke derselbe. Die Gründer, allen voran der Philosoph Andrei Pleşu, waren entschlossen, eine neuartige, im Bildungs- und Forschungssystem des Landes bisher unbekannte und förderliche Institution zu schaffen und zu gestalten: Der einzelne Forscher, die einzelne Forscherin sollten im Mittelpunkt stehen und frei entscheiden können, worüber sie arbeiten wollten. Zugleich sollten die für jeweils ein akademisches Jahr ausgewählten und unterstützten Stipendiaten (Fellows) aber auch miteinander ins Gespräch gebracht werden. Daher waren regelmäßige Treffen vorgesehen, die nicht wie (Partei-) Sitzungen straff geplant und geführt, sondern liebevoll als causeries de mercredi bezeichnet wurden: Sie dienten der Verständigung über die konkreten Forschungsvorhaben der Beteiligten, aber auch der Diskussion von Fragen der Erkenntnis, der Wissenschaft und Gesellschaft insgesamt. Im Laufe der Monate sollte Vertrauen entstehen zwischen den Fellows, Voraussetzung echter Gespräche, und ein Verständnis für das Vorgehen verschiedener Wissenschaftszweige. Derweil sorgte das Institut mit wenig Mitteln, aber großem persönlichen Einsatz für Unterstützung. Dazu zählte damals beispielsweise der Zugang zu Fax- und Kopiergerät sowie auch zu PCs – diese Umstände vergegenwärtigt man sich heute vielleicht nicht mehr, das konnte aber damals karriereentscheidend sein und war unter Umständen mit erheblichen Mühen verbunden. Besonders wertvoll waren auch die internationalen Verbindungen, in denen das NEC entstand, und die Zuwendung der westlichen Partner: Die persönlichen Kontakte zu hochrangigen Kolleginnen und Kollegen war für die ersten Fellows – kaum einer von ihnen hatte zuvor seine Forschungen nach eigenen Maßstäben verfolgen oder gar eine Konferenz im Ausland besuchen können – von großer Bedeutung. Die Fellowships enthielten auch immer die Mittel für einen Extra-Monat im Ausland, an einer Institution, die sich für die spezifischen Forschungen der Einzelnen besonders anbot. Durch die Einbindung des von Anfang an international und hochrangig besetzten wissenschaftlichen Beirats und die Einladung berühmter Gastprofessoren bot das NEC seinen Fellows zusätzliche Möglichkeiten der Vernetzung an.
Alle diese Elemente der Fördertätigkeit des Instituts waren sorgfältig bedacht und basierten auf der Diagnose, die Andrei Pleşu seinem Land und speziell dem Bereich der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften gestellt hatte: weithin ideologisch verkrüppelt und obsolet, unterfinanziert und ideen-arm, beschränkt und parzelliert, unfähig zu Austausch und Kooperation. Dass es möglich wurde, ein solches Angebot für rumänische Forscherinnen und Forscher zu realisieren, ist aber auch der Auf-bruchsstimmung und Hilfsbereitschaft des Westens in der Nachwendezeit zu danken: Staaten und Stiftungen ließen sich von der Idee begeistern und trugen finanziell zu Aufbau und Betrieb des Instituts bei.
Ein Vierteljahrhundert später hat sich der Kontext gewaltig verändert. Rumänien gehört der EU an; Menschen reisen ohne Visa ein und aus, der durchschnittliche Lebensstandard ist gestiegen, die Wirtschaft wächst. Gelder für Forschung in Rumänien (und vieles andere mehr) fließt aus den Fördertöpfen der Union, sei es direkt, sei es über das eigene Bildungs- oder Forschungsministerium. In Bukarest boomen die Geschäfte, Neubauviertel entstehen rundum in der Hauptstadt, die Kommunikations- und Informationstechnologie ist auf modernem Stand. Zugleich freilich ist die politische Situation unerfreulich: echte Reformen gelähmt durch Querelen aller Art, durch Machtkämpfe, Korruption, Kurzsichtigkeit, Proteste und mangelnde Konstanz – in wenigen Jahren wurden die für Wissenschaft und Forschung zuständigen Regierungsressorts mehrfach umgestaltet, getrennt, anderen Ministerien zugeordnet, wieder neu verschmolzen, das zugehörige Spitzenpersonal ausgetauscht (ScienceǀBusiness zählte 2018 sechs ausgewechselte Forschungsminister für die vergangenen zwei Jahre!), was verlässliche Arbeitsbeziehungen nahezu unmöglich macht. Und die rumänischen Staatsausgaben für Forschung und Innovation befinden sich EU-weit auf einem der niedrigsten Plätze.
Eine dermaßen dynamische Periode wie die vergangenen Jahrzehnte stellt eine kleine, unabhängige Institution wie das NEC auf eine harte Probe. Wie viel an Konstanz ist zu halten, welche Maßnahmen sind den Anforderungen der Gegenwart noch angemessen? Wie ist auf die neuen Entwicklungen zu reagieren, welche neuen Aufgaben sind anzupacken?
Das New Europe College ist seit seiner Gründung deutlich gewachsen. Seit der Jahrtausendwende residiert es in einem gepflegten Gebäude, wo Veranstaltungsräume, Büros und Bibliothek untergebracht sind; in Studios können sogar einige Fellows unter dem eigenem Dach beherbergt werden. Es ist wahrlich ein Glücksfall, dass die Schweizerische Eidgenossenschaft die Nutzung dieser Immobilie an das Institut abgetreten hat: Dadurch wurden Aktionspotential und Sichtbarkeit des NEC deutlich erhöht. Zu Vorträgen, Diskussionsrunden oder auch Konzerten kann nun ein größeres Publikum eingeladen werden. Getreu den ursprünglichen Gedanken des Gründers und bestärkt durch Anregungen aus dem international besetzten Stiftungsrat nimmt das Institut neuerdings verstärkt die Aufgabe wahr, auch in die Öffentlichkeit hineinzuwirken. Es will nicht nur zur Innovation in der Wissenschaft beitragen, sondern auch zur Weiterentwicklung einer demokratischen, freiheitlichen Gesellschaft mit Debatten zu relevanten Fragen der Gegenwart. Gerne arbeitet das Institut dabei auch zusammen mit anderen Partnern (Wissenschafts- und Kulturinstituten, Botschaften, zivilgesell-schaftlichen Organisationen).
Das wichtigste Element im ‚Portfolio‘ des NEC sind jedoch Fellowships für herausragende Nachwuchsforscher geblieben. Gewiss, es gibt heute manche Angebote für junge, gute, ehrgeizige Wissenschaftler auch im Osten Europas, wenn nicht im Lande selbst, dann doch international. Kaum einer der Bewerber am NEC ist ohne Auslandserfahrung. Was Fellowships aber bieten können, das ist förderlich wie eh: finanzielle und administrative Unterstützung, intellektuelle Auffrischung und Anregung, Konzentration auf ein wichtiges Projekt, zugleich aber auch Einladung zum Dialog und zur Verständigung mit Anderen. Während zunächst nur rumänische Wissenschaftler berücksichtigt wurden, hat das NEC bald auch Programme mit unterschiedlichen Zielrichtungen aufgelegt. Dazu kamen Module für Rückkehrer aus dem Ausland, mit der Motivation, dem brain drain etwas entgegenzusetzen. Als sich das Institut im Lande gut etabliert hatte, öffnete es seine Pforten für wissenschaftliche Nachwuchskräfte aus den Nachbarländern Rumäniens, schließlich für Interessenten weltweit. Einen besonderen Fokus hat das NEC in den letzten Jahren, mit substantieller Unterstützung der VolkswagenStiftung, auf einen Ausbau der Angebote für begabte Akademiker und Intellektuelle aus den Ländern rings ums Schwarze Meer gelegt: ein gezielter Beitrag zur europäischen Nachbarschaftspolitik im Wissenschaftsbereich.
Eine neue Funktion hat das Institut angenommen, indem es auch als Plattform dient für Alumni und Alumnae, die bei anderen Stellen (Forschungsfonds, Stiftungen) erfolgreiche Projektanträge gestellt haben. Mit seiner Erfahrung, seiner effizienten, zuverlässigen und flexiblen Verwaltung ist es als Servicedienstleister im Vergleich mit den bürokratischen, schwerfälligen Staatsinstitutionen ideal aufgestellt. Das zeigt sich etwa bei den hoch renommierten (und hoch dotierten) grants des European Research Councils: Von den insgesamt sechs Projekten, die von rumänischen Forschern bisher ins Land geholt wurden, sind deren drei vom NEC aus gestellt worden – dieser kleinen, unabhängigen Struktur, einem Winzling gemessen an den großen Universitäten oder den Akademieinstituten! So ermutigt das Institut auch ehrgeizige junge, im Ausland ausgebildete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, nach Rumänien zurückzukehren und von da aus ihre Projekte zu betreiben.
Voraussetzung solcher Leistungen des NEC ist das Engagement seiner langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie verkörpern das institutionelle Gedächtnis, kumulieren Erfahrung und Kompetenz und haben großes Vertrauen aufgebaut - ein ganz wesentliches institutionelles Kapital in solchen Umbruchszeiten. Einen Schatz besitzt das Institut auch in der großen Schar seiner Ehemaligen. Die meisten sind in Universitäten und Forschungsinstituten tätig geblieben und tragen dort zur Reform der Strukturen bei. So darf man konstatieren, dass das NEC eines seiner Gründungsziele erreicht hat: sich für die Erneuerung einer wissenschaftlichen, intellektuellen und politischen Funktionselite einzusetzen.
Für die Fellowships rumänischer Postdoktorandinnen und Postdoktoranden trägt seit nun mehr als zehn Jahren der eigene Staat als Geldgeber bei. Aber um den Grundbedarf des Instituts zu decken und die internationale Ausrichtung zu sichern, bedarf es wie seit 1994 der Unterstützung aus dem westlichen Ausland. Während es kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs eine großzügige Spendebereitschaft gab, ist es dreißig Jahre später schwer geworden, Geld für die Arbeit dieses hervorragenden Instituts einzuwerben – obwohl seine Aktivität unter den heutigen Bedingungen so wertvoll ist wie früher, wenn auch mit anderen gesellschaftspolitischen Begründungen. Aber das NEC wird weiterhin versuchen, Stiftungen in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und anderswo davon zu überzeugen, dass sich ein Einsatz hier „lohnt“, dass für vergleichsweise geringe Mittel große Wirkungen erreicht werden können. Zugleich hat das Institut auch energisch die Suche nach privaten Sponsoren innerhalb Rumäniens angepackt und kann stolz auf erste Erfolge verweisen.
Zum Geburtstag ist diesem initiativen und effektiven Zentrum für herausragende Forschung und intellektuellen Dialog zu wünschen, dass es noch viele Jahre bestehen und im Wandel seiner Mission treu bleiben möge. Zahlreiche Forscherinnen und Forscher, Bürger und Intellektuelle werden Gewinn davon haben, denn dies ist ein Ort, wo Europäer aus Ost und West, aus Nord und Süd sich treffen und ganz selbstverständlich in verschiedenen Sprachen vortragen, diskutieren und sich austauschen können.

Foto: NEC
25 Jahre New Europe College (NEC) in Bukarest
Der Leuchtturm der Advanced Studies in Südosteuropa
Die Anfänge waren mehr als bescheiden: Die wenigen Stipendiaten wohnten in den Wohnungen des Direktors Andrei Pleșu und der Architektin Marina Hasnaș, die die administrativ-finanzielle Seite des Vorhabens betreute. Von dort wurde auch die Verwaltung gemacht, es gab kein eigenes Gebäude, keine Bibliothek und keine weiteren Angestellten. Treffen der Fellows fanden in den Gärten befreundeter Hausbesitzer statt. Heute ist das NEC in Bukarest in einem schönen eigenen Gebäude in der Strada Plantelor im malerischen Viertel Măntuleasă untergebracht mit Räumen für Fellows aus aller Welt, es gibt ein eingespieltes Team, das zahlreiche Programme und Aktivitäten anleitet und eine wohl ausgestattete geisteswissenschaftliche Bibliothek.
Dass dieses Zentrum für fortgeschrittene Studien seinen Anfang nehmen konnte, hat mit dem Berliner Wissenschaftskolleg zu tun, wo der frühere rumänische Kulturminister Andrei Pleșu als Fellow sich für die Idee dieser nach amerikanischem Vorbild eingerichteten Forschungseinrichtung begeisterte. Das Angebot von der damaligen Wiko-Leitung unter Wolfgang Lepenies, doch einen Antrag zu formulieren, den dann das Wiko bei Stiftungen oder Institutionen unterstütze, führte tatsächlich zum Erfolg und dem bescheidenen Beginn des heutigen, weit über Rumänien hinaus strahlenden Kollegs. Möglich wurde dies, weil eine Reihe von Institutes for Advanced Studies, Stiftungen und Ministerien in Europa und Amerika einen Preis an Pleșu verliehen, der die finanzielle Basis des neuen Kollegs werden sollte.
Direktorin des NEC ist mittlerweile die Pianistin und Musikwissenschaftlerin Valentina Sandu-Dediu, die 2014 Andrei Pleșu ablöste. Im Gespräch mit ihr und Lelia Ciobotariu, die im Kolleg als Nachfolgerin von Marina Hasnaș für die Geschäftsführung zuständig ist, sind die Anfänge des Instituts weiterhin Anlass für das Staunen, was sich aus dem Preis, den Pleșu seinerzeit erhielt, entwickelte. "Es haben etwa 1000 Stipendiaten bisher das NEC frequentiert, davon waren 75% rumänische WissenschaftlerInnen."
Seit den Anfängen gibt das NEC keine Themenausrichtung vor, innerhalb derer sich die StipendiatInnen bewegen sollen, sondern ist offen für viele Bewerbungsthemen. "Bei ihrer Auswahl folgte es keinem allgemeinen jährlichen Programm, sondern das NEC wollte immer eine möglichst freie Auswahl der Themen vor allem aufgrund der Qualität der Stipendienanträge gewährleisten", erläutert Frau Sandu-Dediu. Eine Haltung, die bis heute das Institut prägt: "Die wissenschaftliche Unabhängigkeit ist für uns das wichtigste." So ist das Kolleg auch keine vom rumänischen Staat finanzierte Institution, sondern greift auf wechselnde und vielfältige Unterstützung zurück - vor allem internationale.
Dabei hat sich in den zweieinhalb Jahrzehnten in der Finanzierung einiges verändert. Seit dem Beginn hat etwa das deutsche Innenministerium über ein Programm die fixen Kosten für die Verwaltung getragen. Diese Förderung lief nach 15 Jahren aus, so dass das Colegiu auf diesem Gebiet sich immer wieder neu orientieren muss. Frau Ciobotariu erwähnt, dass diese Anstrengungen von großem Erfolg gekrönt sind. So hat das NEC nicht zuletzt durch die Arbeit der wissenschaftlichen Direktorin Anca Oroveanu drei EU-Projekte an Land gezogen, eines davon forscht unter der Leitung von Constanța Vintilă-Ghițulescu zu Luxus, Mode und Sozialstatus im frühneuzeitlichen Südosteuropa. Ebenso wird das Projekt Pontica Magna von der deutschen VolkswagenStiftung gefördert, das auf das frühere Balkans-Black Sea-Project folgt und WissenschaftlerInnen von der Schwarzmeer-Region bis nach Zentralasien zusammenbringt. Hauptfinanzier ist zur Zeit aber die Schweiz: Die Schweizer Landis & Gyr Stiftung übernahm die Absicherung der Grundkosten für Gebäude, Personal u.a. Schon seit dem Beginn des Vorhabens engagierte sich die Schweiz. Als die Frage eines eigenen Gebäudes sich stellte, fand sich das fast verfallene Haus der Schweizer Kaufmannschaft, was der eidgenössische Botschafter sofort unterstützte. Die Architektin Marina Hasnaș konnte mit ihrem Lehrer Prof. Nicolae Vlădescu auch einen Fachmann animieren, sich des Projekts anzunehmen, so dass das NEC seit 2000 im eigenen schmucken Gebäude mit großem Garten residiert.
Über die Jahre hat Katharina Biegger für das Wiko die Arbeiten mit dem NEC koordiniert und vorangebracht. Sie konstatiert ebenfalls: "Die Verhältnisse haben sich natürlich stark geändert, und in diesem Sinne hat auch die Arbeitsweise des NEC sich modifiziert, erweitert, dynamisiert, flexibilisiert. So erfordern es die modernen Bedingungen in der academia - und offenbar auch die Finanzierungsbedingungen der Förderinstitutionen, ob privat oder staatlich. Das bringt ein unabhängiges Institute for Advanced Study mit der Einladung von Geistes-/Sozialwissenschaftlern, die ihre Arbeitsthemen frei bestimmen können, in eine gewisse Zwangslage: Denn heute wird vermehrt nach output, outreach, policy relevance, Anwendbarkeit usw. verlangt. Trotzdem hat es das NEC bisher geschafft, die anspruchsvolle Balance zwischen Anpassung und Kontinuität in seiner Kernaufgabe zu halten."
Dass das NEC einen sichtbaren Einfluss auf die Kommunikation innerhalb der Wissenschaftslandschaft Südosteuropas hat, lässt sich allein schon an der Zahl und Karriere seiner Fellows ablesen. Nicht nur fast 1000 RumänInnen, denen der Aufenthalt den Austausch mit ausländischen WissenschaftlerInnen ermöglichte und oft einen entscheidenden Sprung in ihrer Forscherkarriere bedeutete, sondern auch viele Gäste aus dem Ausland lernten die rumänische Hauptstadt als Forschungsschauplatz durch das NEC kennen. Unter den Fellows befanden sich u.a. der Philosoph Horia Patapievici, der Kulturwissenschaftler Andrei Oișteanu, der Leiter des Bukarester Germanistiklehrstuhls Gabriel Horațiu Decuble, die Schriftstellerin und Philologin Ioana Părvulescu, die Schriftstellerin Smaranda Vultur, der Kunsthistoriker Victor Stoichiță, der Temeswarer Soziologe Robert S. Reisz, der Historiker und Aussenminister Mihai-Răzvan Ungureanu. Aus dem Ausland waren Gäste Wolfgang Kemp, Keith Hitchins, Jacques Derrida, Herta Müller, Adam Michnik, Timothy Garton Ash, Yehuda Elkana u.v.a.
Den 25. Geburtstag begeht das NEC mit diversen Veranstaltungen. Zum Auftakt erhielt es bereits im letzten Jahr Besuch von Staatspräsident Klaus Johannis, es folgten Debatten mit dem früheren Direktor des Wiko, dem Verfassungsrechtler Dieter Grimm und dem St. Galler Politologen Dirk Lehmkuhl; den Abschluss bildet im November ein Vortrag des Schriftstellers, Dissidenten und jetzigen Botschafters Rumäniens in Berlin, Emil Hurezeanu.
Die Zeitschrift Dilema veche (Gründer: Andrei Pleșu) brachte in ihrer Ausgabe vom 23-29. Mai 2019 (nr. 796) ein Dossier zum 25. Geburtstag des NEC heraus mit Interviews und Beiträgen von Pleșu, Sandu-Dediu, Lepenies, Joachim Nettelbeck (Wiko), Heinz Hertach (Landys & Gyr) u.a.

Reisen in Bessarabien
Russische Reiseberichte aus dem 19. Jahrhundert
Die Annexion eines Teils der Moldau als "Bessarabien" durch das russische Zarenreich während der napoleonischen Kriege lag auf der Linie der Expansion der orthodoxen Dynastie nach Süden - Richtung Schwarzes Meer und Bosporus. Mehrere militärische Siege gegen das Osmanische Reich hatten zur Eroberung des Wolgagebiets bis zur Mündung geführt. Ergebnis war die Gründung von Odessa. Und während der Frieden von Kutschuk-Kainardschi das Habsburger-Imperium zur Annexion der kleinen Bukowina veranlasste, nahm sich das russländische Reich später den Teil der Moldau zwischen Prut und Dnjestr und übte bis in das 19. Jahrhundert auch politischen Einfluss auf das Donaufürstentum Moldau aus. Ist in der deutschen Geisteswissenschaft nur wenig bekannt über das Verhältnis von Russland zu seiner neuen Eroberung, so bietet die vorliegende Dissertation von Galina Corman nicht nur Einblick in die russische Reiseliteratur, sondern ebenso in die historischen Entwicklungen des Zarenreiches.
Es ist ein strikt deduktiver Ansatz, der das methodische Schema der Arbeit vorgibt: Zunächst werden die (kultur)historischen Vorgänge in Russland geschildert, bevor dann die Sehweisen in der Bessarabien-Reiseliteratur in ein Verhältnis zu diesen gesetzt werden. Umfangreich ist die Vorgeschichte der Landschaft geschildert, von der Antike über die Tataren bis zur Osmanischen Herrschaft. Dabei wird deutlich, dass dieser östliche Teil der Moldau durchaus etwas besonderes war, da hier die osmanischen Strukturen sich stärker artikulierten als in der Walachei und der (später rumänischen) Moldau: Seit 1457 bauten die Sultane die Grenzfestungen am Dnjestr (Hotin, Soroca, Chilia, Bender/Tighina, Cetatea Alba/Akkerman) und an der Donau zu administrativen Einheiten (Reayas) aus und besiedelten vor allem den Süden (Bugeac, Budschak) mit Nogai-Tataren. "Die Umwandlung der bessarabischen Festungen in Reayas sowie die Ansiedlung der Nogai-Tataren trug vom 16. Jahrhundert an viel zur Entfremdung des Territoriums zwischen Prut und Dnjestr vom Rest des Fürstentums Moldau und einer Verfestigung seines Charakters als Grenzregion bei." (S. 41-42) Die Tataren wurden als Grenztruppen gegen die Kosaken eingesetzt, gingen aber auch auf Raubzüge gegen die moldauischen Städte. Ihre Spuren waren im 19. Jahrhundert noch in Bessarabien zu finden.
Die als Einteilungskriterien der Arbeit dienenden drei Epochen teilen das Jahrhundert der russischen Herrschaft in Bessarabien aus der Sicht der Reiseliteratur in eine Anfangsphase bis etwa 1820, gefolgt von einer mittleren Epoche bis in die 1850er Jahre, um mit der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg abzuschließen. Diesen drei Phasen sind die Merkmale des "halbasiatischen Bessarabien-Bildes", der "Unser-Bessarabien"-Phase und der abschließenden "moldauisch-jüdischen Okraina"-Phase zugeordnet.
Was ist damit gemeint? Das "halbasiatische Bessarabien-Bild" unmittelbar vor und nach der Annexion dieses östlichen Teils des unter osmanischer Hoheit stehenden Fürstentums Moldau resultiert aus einer komplexen Wahrnehmung Bessarabiens im Zusammenhang mit der Expansion des Zarenreichs nach Süden. In den vier Türkenkriegen zwischen 1736 und 18012 hatte Russland mehrfach die Moldau besetzt und wieder geräumt. In der Geschichte des Zarenreichs waren die Eroberungen der Dnjestr-Festungen vielfach besungene Höhepunkte militärischer Erfolge (Lomonosov, Deržavin), die Donaufürstentümer gerieten mehrfach unter die Hoheit Russlands, bevor dann während den napoleonischen Kriegen Bessarabien annektiert werden konnte und der Prut die westliche Grenze zum Donaufürstentum Moldau bildete. Corman verwebt diese Ereignisse gekonnt mit den Diskursen des allmählich koloniale Züge aufweisenden Zarenreichs, in denen die neu erworbenen Gebiete beschrieben wurden. So ist es interessant zu lesen, wie Katharina II. die Expansion zum Schwarzen Meer mit einem "Griechen-Projekt" idealisierte, das die antiken Bilder mit der handfesten Unterstützung der griechischen Nationalbewegung gegen die Osmanen ergänzte. So zählten Griechen zu den Neusiedlern Bessarabiens. Weitere waren Bulgaren, Gagausen, Serben, Schweizer, Deutsche, die die einheimische Bevölkerung der Juden, Moldauer, Russen, Ukrainer, Lipowaner (raskolniki) zu einem multiethnischen Konglomerat erweiterten. In der ersten Phase der Reisebeschreibungen findet Corman denn auch positive wie negative Bemerkungen über dieses "bunte Gemisch" der Bevölkerung, wie es der Militär Aleksandr F. Veltmann in Chişinău (Kischinjow) schilderte (S. 168). Das Bild Bessarabiens war zu Beginn von einem "imperial-orientalischen Diskurs" bestimmt, der Bessarabien als "asiatisch" wahrnahm, um es von dem sich selbst als "europäisch" deklarierenden Zarenimperium abzusetzen. So fiel den reisenden Beamten, Militärs, Gouverneuren, Dichtern die "Wildheit" des Landes und seiner Bewohner von den Tataren über die Roma und die Moldauer bis hin zu den Bojaren auf. Zugleich wurde Bessarabien aber auch als "Garten" verklärt, als "Italien" mit einer antiken Vergangenheit (Traianswall, Ovidmythos), wo Russland seine heroische Kriegsgeschichte geschrieben hatte. Nicht nur der antike Hintergrund, sondern auch die genauere Wahrnehmung der landwirtschaftlichen Leistungen und Möglichkeiten (insbesondere des Weinanbaus), der "südlichen" Atmosphäre und des gemeinsamen orthodoxen Glaubens ließ ein "europäisches" Bild von Bessarabien entstehen.
Zentral in dieser frühen Phase der Reisebeschreibungen und darüber hinaus sind natürlich die Bezugnahmen Alexander Puschkins auf seinen Versetzungsort Chişinău und die umgebende Landschaft, wo er von 1820-1823 lebte und ein Viertel seines Werks schrieb. Zwar gibt es einige wenig schmeichelnde Aussagen zur Stadt, aber zugleich widmete er den Roma eines seiner berühmtesten Gedichte (Cygany). Puschkins weitere Bezugnahmen in Schwarzer Schal, Kirdali, An Ovid u.a. weisen ebenso die widersprüchliche Wahrnehmung Bessarabiens in den unterschiedlichen, zunächst auf die Selbstdefinition Russlands als kolonialer, den europäischen Mächten ebenbürtiger Macht reflektierenden Diskursen auf.
Diese "koloniale" Sicht wandelt sich in der Zeit bis in die 1850er Jahre, als vor dem Hintergrund des sich entwickelnden russischen Nationalismus über die ersten Fremdheitserfahrungen hinaus Bessarabien als "unser" beschrieben wird, als russländischer "Süden", der einer Zivilisierungsmission ausgesetzt werden müsse. Jetzt werden auch die einzelnen ethnischen Gruppen kritischer betrachtet: die Moldauer als "rumänisch", die Juden als gierig, aber auch geschäftstüchtig und fähig, die Deutschen als fordernd und kalt, die Bulgaren hingegen als "Brüder". Bessarabien erscheint als russische Provinz mit ihren Eigenheiten.
Mit der Verschärfung des Nationalismus und den sozialen Krisen und Auseinandersetzungen im Zarenreich bis zum Ersten Weltkrieg wird auch der Diskurs der Reiseberichte pauschaler. Bessarabien hat scheinbar nicht den Erwartungen entsprochen, der Ton wird antisemitischer, nationalistischer und nostalgischer bezogen auf die Heldentaten der Armeen Katharinas II. oder den Aufenthalt Puschkins. Zudem erscheint Bessarabien im Lichte des gewachsenen Antisemitismus und der Peripherie-Diskurse. Alles, was nicht positiv erscheint, wird als "jüdisch" deklariert und Bessarabien zu einer Okraina, einem Grenzstreifen, einer marginalen Provinz. "Die Einwohner Bessarabiens wurden von den Reisenden zum Ende des 19. Jahrhunderts hin pauschal als moldauisch-jüdisch bezeichnet und mit ethnischen Flüchtlingen, Sträflingen und Aufständischen in Verbindung gebracht." (S. 303)
Durch den methodischen Ansatz kann die Arbeit klare Linien ziehen und den Konnex zu russischen Diskursen der Nation herstellen. Andererseits werden so die spezifischen Besonderheiten jeder einzelnen Beschreibung und ihres Autors weniger stark gewichtet. Es wäre also noch Potenzial vorhanden, das Thema in vielen Details mit Gewinn komplexer darzustellen. Dennoch bleibt Cormanns Buch ein gut zu lesender, die Forschung vielfach bereichender und im deutschen Sprachraum inaugurierender Beitrag. Vom Verlag exzellent gestaltet (vielleicht hätten die Anmerkungen einen Punkt größer gesetzt werden können), wären lediglich eine Reihe von Setzfehlern zu monieren. Ansonsten gilt: Ein spannendes Thema in gewinnbringender, opulenter Ausführlichkeit abgehandelt!
Galina Corman: Das Bessarabien-Bild in der zeitgenössischen russischen Reiseliteratur 1812-1918. Leipziger Universitätsverlag 2015 (Veröffentlichungen des Moldova-Instituts Leipzig, 6), 1 Abb, 373 Seiten, ISBN 978-3-86583-987-9

Rumänische Literatur als Weltliteratur (I)
Globalisierung und Identität - ein Sammelband spürt den Anteilen der rumänischen an der "Weltliteratur" nach
Dass die rumänische Literatur aus deutscher Perspektive prominenten Anteil an der "Weltliteratur" habe, würden wohl nur wenige zugestehen wollen. Zuwenig ist (auch hierzulande) die Literatur in rumänischer Sprache und ihre Geschichte einem größeren Publikum präsent, um ihre Stellung im Vergleich etwa mit der englischen, französischen, russischen oder japanischen zu bestimmen. Zudem wäre bei dieser Operation erst einmal zu klären, was denn "Weltliteratur" sein solle - gerade im Lande Goethes, von dem ja der Begriff stammt. Aber auch in Rumänien selbst wäre angesichts eines vielfach beschriebenen tief verwurzelten Minderwertigkeitskomplexes - als Bruder des nationalen Größenwahns - die Perspektive, die eigene Literatur als Teil der weltweiten Literaturbewegungen mit all ihren Implikationen zu sehen, wenig verbreitet. Vielmehr halten viele die eigene Literatur für so extrem bedeutend und für die "nationale Identität" so unumgänglich, dass ihnen deren Studium genügt, um den Stellenwert der rumänischen Literatur zu beweisen. Der Kontakt mit anderer Literatur gilt da oft nur als eine marginale Perspektive. Nicht zuletzt das 40 Jahre währende Regime der kommunistischen Partei hat Offenheit und Welthaltigkeit der Literatur nur selten wirklich befördert.
Aus dieser Situation heraus bedurfte es fast 30 Jahre nach dem Umbruch der "Revolution" von 1989 eines neuen literaturwissenschaftlichen turns, um die eigentlich ja gar nicht so abwegige Frage nach der Welthaltigkeit der rumänischen Literatur auch in Rumänien zu stellen. Dieser vor allem in den USA formulierte methodologische turn stellt nach dem spatial turn und postcolonial turn die Hinwendung zu den planetary studies in der Literatur dar, die Überwindung der nationalsprachlichen Betrachtung von Literatur, der Verzicht auf den Konnex von Literatur und Nation, die Hinwendung zu den Interaktionen zwischen unterschiedlichen Sprachen und Literaturen, den crossroads und Intersektionen - mithin ein Wechsel, der weit reichende Folgen und Voraussetzungen hat.
Diese neue Perspektive auf die rumänische Literatur in zahlreichen Beiträgen genauer zu exemplifizieren und im Detail an einzelnen Autoren und Epochen zu erproben, hat sich der hier vorzustellende voluminöse Sammelband - herausgegeben von den Literaturwissenschaftlern Mircea Martin (Bukarest), Christian Moraru (University of North Carolina) und Andrei Terian (Hermannstadt/Sibiu) - zur Aufgabe gemacht. Wegen seiner Bedeutung und zahlreichen faktischen Untersuchungen sei etwas ausführlicher zunächst das in der Einleitung zu dem Band dargelegte Konzept der world literature näher erörtert, bevor in einem weiteren Beitrag die Aufsätze vorgestellt werden und eine abschließende Einschätzung einfließt.
I.
Die Herausgeber stützen sich in ihrem Ansatz vor allem auf eine neue Forschungsrichtung innerhalb der literarischen Studien, in der die früheren Konzepte von der Verbindung von Sprache, Literatur und Nation, wie sie seit Herder im 19. und 20. Jahrhundert vielfach postuliert wurden, in Frage gestellt werden und auf die Interaktion zwischen den und innerhalb der Sprachen und Literaturen abgehoben wird. Herder habe in seiner Abhandlung Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit 1774 auf einen "unauflöslichen" Zusammenhang von Sprache, Literatur und Nation hingewiesen, wobei Kultur und insbesondere die Literatur der Ausdruck eines "Geistes" jeder Nation sei. Literaturgeschichte - so die Herausgeber - trage so entscheidend zur ethno-cultural formation der Nationen bei- eine Idee, die im 19. Jahrhundert große Tragweite in der Phase der Nationalstaatsbildung erreichen sollte. Entsprechend halten die Autoren fest:
...] all nineteenth-century European literary histories had a clearly marked, political and identitarian agenda. They strove, accordingly, to set up or reinforce
the one language-one-nation-one-literature 'organic' correspondence as described above, to legitimate claims to national territory, to prove, also by way of literary analysis, this existence and
significance, inside that space, of a specificity 'typical' of the national spirit and, more generally, to argue, from the latter, for the greatness of their nations. (S.9)
Diese enge Bindung von Literatur(geschichtsschreibung) und Nation(alstaat) hielt sich lange und die Autoren führen als rumänisches Beispiel die große Darstellung der rumänischen Literaturgeschichte durch George Călinescu an, die, als sie 1941 erschien, die gerade Tatsache gewordenen Gebietsabtrennungen an Ungarn, Bulgarien und die Sowjetunion zum Anlass nahm, die Geschichte der rumänischen Literatur als Beleg der Idee von der Einheit der rumänischen Nation zu operationalisieren - bis hin zu zeittypischen antiungarischen und antisemitischen Anwandlungen, wie die Herausgeber betonen. Auch das kommunistische Regime trug wenig zur "worldedness", der Welthaltigkeit der rumänischen Literatur bei.
Wie wird in dem Band world literature verstanden? Gegen die angedeutete direkte Beziehung von Nation und Literatur(geschichtsschreibung), also gegen den methodological nationalism (Ulrich Beck) betonen die Herausgeber mit einem Set von theoretischen Vorschlägen, die in den letzten zehn Jahren etwa diesen turn zur postnationalen, transnationalen Betrachtungsweise vorangetrieben haben, das Weltsystem (Wallerstein) als epistemological framework of literary and cultural analysis (S. 2). Die rumänischen Beispiele werden "als Welt" und "mit der Welt" gelesen, was sich aus deren Welthaltigkeit und ihrer intersektionalen Position in der Welt der Netzwerke ergebe:
The latter consists in a whole panoply of literary, cultural, and material geophenomena that render what is commonly designate as "Romanian literature" and its historical, national-territorial perimeter sectors of larger systems of sites and junction points where and through which such macrounits (zones, spheres, trans- and intercontinental corridors, global passageways) overlap, link up, run, and mark their presence. This means that this worldedness sometimes plays out as this literature's affiliations - plural, shifting, litigious - with bigger geoaesthetic flows, aggregates, and mentalities: regional systems and "subsystems" such as Eastern Europe and the Balkans, sub- and supranational cosmopolitan movements like the Enlightenment and the avant-garde, ethnolinguistic communalities and communities such as the Romance world, then wider, "Western", or even worldwide circulation genres, themes, styles, fashions, epistemes. (S. 3)
Was diese Kaskade an Begriffen der Bewegung und Verbindung zeigen möchte, ist offensichtlich, dass nun, wo vorher die strikte Abgrenzung von Nationen und Literatur herrschte, jetzt die fast schon flüssig erscheinende Fluktuation der literarischen Beziehungen zu beobachten sei. Als ihr bevorzugtes Modell dieser Beziehungen schweben denn auch den Herausgebern die "vases communiquants" der Surrealisten vor. Es ist ein fluides System, in dem alles mit allem zu tun haben kann. Dabei wird die Realität der nationalen Begrenzung aber keineswegs geleugnet oder einer völligen Irrelevanz des Nationalstaates gehuldigt, sondern es ist die Perspektive auf viele miteinander verbundene Netzwerke, so dass die "nodale" oder interkommunikative Geschichte die nationalen Geschichten neu konzeptualisiert. Gegen den "Tunnelblick" (Greenblatt) von individuellen und kollektiven Identitäten wollen die AutorInnen die vielen in das Muster der rumänischen Literatur gewebten Welten aufzeigen. Dabei ist eben die nationale Literatur ein besonderer nodaler Punkt in einer größeren Einheit, in der nicht mehr die simplizistische Sicht auf kulturelle Mechanismen vorherrscht, wonach es eine "erste" und "zweite" und eine "dritte" Welt gebe. Vielmehr sei der nodale Blick ein ethisch und politisch aufbauender, in dem sich zwar die Zentren nicht in Luft auflösen, aber mehr Kerne (nuclei), Umschlagplätze (hubs) und weichere Zentren wahrnehmbar seien. "Marginozentrisch" kann ein Knoten (node) sein, und gewinne dann - wie etwa das Banat innerhalb Rumäniens - im neuen Rahmen gegen das Klischee vom "Provinzialismus" eine unvorhergesehene und unorthodoxe Zentralität. Was das Buchprojekt vorschlägt, ist eine geographische Neuvermessung jenseits der nationalen Diskurse: "Tracing all these relations entails painting a world, doing a geographer's job, uncovering the fluid, supra- and para-statal continuum in which literature aggregates. It is topo-poetic; it projects - makes - a space." (18)
Hinzu kommen Bewegungen, Wanderungen von Themen, Genres, Diskursen, -ismen durch die Zeit und den Raum. Ihre Routen zu verfolgen, macht die spatiale Prägung des Konzepts der AutorInnen aus. Sie berufen sich dabei auf einen Set von GeisteswissenschaftlerInnen, die in den letzten Jahren die theoretische Klärung der Reterritorialisierung der Literatur, die Spatialisierung, den "methodologischen Kosmopolitismus" voran getrieben haben. Unter ihnen sind Casanova, Moretti, Gosh, Damrosh, Wesphal, Cornis-Pope, Dimock, Greenblatt, u.v.a. zu nennen, die auch von den BuchbeiträgerInnen immer wieder zitiert werden.
Wiewohl der Moderne als Referenz ihrer Theorie verpflichtet weisen die Autoren vor ihrer Einführung in die Ausätze darauf hin, dass gerade die Vor- und Frühmoderne der Renaissance und des Barock dem komparatistischen Modell dieser planetarischen Literaturwissenschaft entgegenkomme, da sich in jenen Epochen der Nationalstaat erst im Embryonalstadium befunden habe. Entsprechend blicken die ersten Beiträge auch auf die literarischen Verhältnisse vor der Vereinigung von Moldau und Ţara Românească (Walachei).
Romanian Literature as World Literature. Edited by Mircea Martin, Christian Moraru and Andrei Terian. New York, London, Oxford: Bloomsbury Academic 2018 (Literatures as World Literature), 357 Seiten, ISBN 978-1-5013-2791-9
Rumänische Literatur als Weltliteratur (II)
Globalisierung und Identität - ein Sammelband spürt den Anteilen der rumänischen an der "Welt"literatur nach
Ist das Programm einer "planetarischen" Literaturwissenschaft in der Einleitung methodisch entworfen, so kann der erste der 15 Beiträge doch überraschen. Denn gegen die in der Beitragsabfolge waltende Chronologie von den Texten Nicolae Milescus und Dimitrie Cantemirs aus dem 17. Jahrhundert bis zu Herta Müller und Norman Manea steht als erster Aufsatz eine Betrachtung über Mihai Eminescu als "Nationalpoet" und seine indischen Interessen. Mitherausgeber Andrei Terian ist sich der besonderen Vorgehensweise durchaus bewusst ("[...] do not national poets come about and establish themselves - nationally - by turning their backs to the wide and divers world of others, to the very domain of worldedness?"), aber weitet das Feld aus auf eine globale Liste der "Nationalpoeten", um dann - überraschend genug - bei Eminescu insbesondere dessen von Schopenhauer inspiriertes Interesse an der indischen Mythologie und Literatur als Basis eines gescheiterten Nationalepos zu entdecken. Eminescu sei sich der Nichtübertragbarkeit der ästhetischen Leistungen etwa Shakespeares oder Goethes in die rumänische Literatur bewusst gewesen und habe erst über den Umweg zur indischen Literatur das Selbstbewusstsein erlangt, rumänische Themen eigenständig zu bearbeiten - Indisch sei ihm wie ein Teil des Rumänischen vorgekommen!
Diese Welthaltigkeit bei Eminescu entdeckt Bogdan Crețu im 17. Jahrhundert bereits in den transitionalen Biographien und Werken zwischen Ost und West von Nicola Milescu Spătarul und Dimitrie Cantemir. Ausgehend von einer Kritik der auf die Nation bezogenen Literaturgeschichtsschreibung seit dem späten 19. Jahrhundert, der Crețu eine Vernachlässigung und
Verschweigung der transnationalen und multilingualen Verhältnisse des Spätmittelalters zugunsten einer "rumänischen" Literaturgenese unterstellt, finden sich in den
beiden adeligen Autoren Formen einer anderen "Originalität". Denn im 17. Jahrhundert hieß schreiben, auf der Basis von Gelehrtheit Wissen zu sammeln, übersetzen, kompilieren, exzerpieren, etc.
Auch dies eine gute Ausgangsbasis für "transnationale" Literatur. Milescu, der als Reisender nach Russland und gar bis China kam, folgte den Gepflogenheiten der Zeit und
integrierte in seinen Reisebericht Übersetzungen westlicher Reisetexte. Cantemir hingegen schuf mit Historia Hieroglyphica (1705) eine byzantinische Weltanschauung mit
neuer Sprachästhetik und weitem Blick nach Ost und West, ein einzigartig verschmelzendes Werk und eigentlicher Ursprung rumänischer Literatur.
Von einer stärker durch den Blick auf die Einwirkung von Imperien geprägten Perspektive macht Caius Dobrescu die 'rumänische' Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts als eine zwangsläufig welthaltige aus. Insbesondere Cantemir und der habsburgische Beamte Ion Budai-Deleanu mit seinem allegorischen Werk Țiganiadă lassen inter-, para- und metaimperiale Merkmale erkennen, die Dobrescu um transmetropolitane Aspekte etwa der rumänischen '48er und der Junimea-Generation ergänzt. Präziser erscheint Alex Goldiș in seiner Wiederaufnahme des Themas der nationalen Literaturgeschichtsschreibung, indem er Călinescus topographische Abgrenzung mit Emil Lovinescus temporalem Entwicklungsansatz konfrontiert. Letzterem ging es um eine zeitliche Diskrepanz zwischen westlicher und rumänischer Literatur, die aber nicht ausschließe, dass auch die scheinbar 'imitierende' Kultur eigenständige, „organische“ und „natürliche“ Werke hervorbringe. Eine „interaktionale“ Geschichtsschreibung der Literatur mache deutlich, „that even if cultural trade among nations has often been conducted on unequal terms, literary modernity has brought about a world space of knotty intersections wherein the East has also helped construct the West.“ (S. 106) Goldiș weist explizit auf die Funktion der Übersetzungen seit der Renaissance hin, die entscheidenden Anteil auch an der Entstehung der westlichen Literatur hatten und bereitet Thesen von Mihaela Ursu vor, die im letzten Beitrag des Bandes die Geschichte der Translationen ins Rumänische Revue passieren lässt. Die Frage der Originalität und Beeinflussung geht Carmen Mușat, Herausgeberin der Zeitschrift Observator Cultural, noch einmal mit Lovinescu und seinem eminenten Schüler Tudor Vianu an, um auch die vergangene Literatur als Teil jenes nodalen Systems zu profilieren, das die globale Literatur bilde. Wie Goldiș nennt Mușat unter den Beispielen des Einflusses das überraschende der Beat Generation, die auf die optzeciști („80er“) wie etwa Mircea Cărtărescu seinerzeit Einfluss ausübte. Teodora Dumitru führt diese Beispiel ausführlicher in ihrem Beitrag aus.

ИНТЕРКОСМОС
Zwei Legenden der Raumfahrt im Berliner Planetarium
Fotos: www.kultro.de
Die pilotierte Raumfahrt hat bereits eine Geschichte von mehr als 50 Jahren aufzuweisen und mehr als 520 Menschen gehören mittlerweile zu dem exklusiven Club jener Auserwählten, die die Erde verlassen haben und den Planeten vom Kosmos aus betrachten konnten. Zwei dieser außergewöhnlichen Menschen standen im Mittelpunkt eines seltenen Zusammentreffens im Berliner Planetarium, wo Sigmund Jähn und Dumitru Prunariu erstaunliche Einsichten in dem allgemeinen Publikum kaum zugängliche Aspekte der menschlichen Raumfahrt eröffneten.
In seinem Vortrag bezog sich der erste deutsche Kosmonaut Sigmund Jähn vor allem auf die Umstände seiner Auswahl zum sowjetischen Programm "Interkosmos", das erstmals Angehörige anderer Staaten aus dem sowjetischen Einflussbereich an der Raumfahrt teilhaben lassen sollte. Jähn war Jagdflieger in der DDR und als solcher eines Tages mit zwanzig anderen Piloten zu einer Auswahl beordert worden. Er zeigte Interesse und erfüllte die geforderten gesundheitlichen Kriterien, so dass er in die "Sternenstadt" bei Moskau eingeladen wurde, wo weitere Auswahltests stattfanden. Kritisch wurde es für ihn, als ein Arzt glaubte festzustellen, dass Jähn der Geruchssinn fehle, was aber sein sowjetischer Kollege schnell mit einer stark riechenden Flasche als unzutreffend qualifizierte. So gelangte der DDR-Pilot in die engere Auswahl und schließlich ins All in das Saljut-6 Raumlabor.
In der zweiten Gruppe des Interkosmos-Programm wurden 1981 auch zwei Rumänen ausgewählt - Dumitru Prunariu und als Ersatzmann Dumitru Dediu. Prunariu war 26 Jahre alt und hatte Ingenieurwissenschaften studiert. In seinem umfassenden Vortrag schilderte er nicht nur seine eigene Teilnahme, sondern gab eine umfassende Übersicht über die Entwicklung der Raumfahrt. Dies ergab sich auch vor dem Hintergrund, dass Prunariu nach seiner Reise ins All mit der Sojuz-40-Rakete zur Saljut-6 sich insbesondere nach dem Fall des Eisernen Vorhangs weiterhin in den Gremien der Raumfahrt wie etwa der ESA (European Space Agency) engagierte und hohe Posten in internationalen Organisationen zur Raumfahrt innehatte, wie etwa den Vorsitz im UN-Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums (COPOUS) oder der rumänischen Weltraumbehörde. So kam das Publikum in den Genuss einer Darstellung von meist wenig bekannten Details der Raumfahrt"szene", deren ProtagonistInnen Prunariu alle persönlich zu kennen schien. Besonders hob Prunariu hervor, dass er nicht nur die erste Frau im All Valentina Tereškova oder den ersten das Raumschiff verlassenden Kosmonauten Alexei Leonov häufig spricht, sondern noch mehrfach Hermann Oberth, den aus Siebenbürgen stammenden Begründer der neueren Raketenforschung in Nürnberg besucht hat. Der hoch dekorierte Prunariu war für ein Jahr Botschafter in Moskau und ist Träger der Jurij-Gagarin-Medaille der Internationalen Astronautischen Föderation und wie Jähn der Goldmedaille der Hermann-Oberth-Werner-von-Braun-Gesellschaft.
Seine eigene Landung nach dem siebentägigen Aufenthalt im All beschrieb er als nicht ganz einfach, da sich der Landefallschirm etwas spät geöffnet hatte und durch den harten Aufprall die Kapsel umstürzte.
Prunariu machte deutlich, dass die Raumfahrt mittlerweile keine ohne konkreten Zweck betriebene Spielerei ist, sondern durch die weltweite Kooperation ein Beispiel für zukünftige Problemlösungen darstelle. Mittlerweile haben bereits zahlende Touristen das All besucht und es fand ein 500 Tage dauerndes Experiment zum Test der psychologischen Belastungen bei einem Mars-Flug statt. Die Zukunft schien an diesem Abend sehr nahe gerückt.





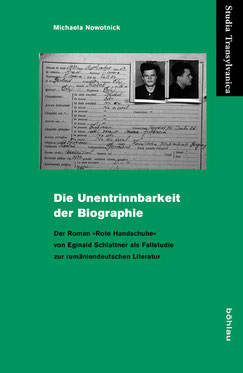
Die Unentrinnbarkeit der Biographie
Eine wissenschaftliche Arbeit über Eginald Schlattner
Mit seinen Büchern "Der geköpfte Hahn" (1998) "Rote Handschuhe" (2001) und "Das Klavier im Nebel" (2005) hat Eginald Schlattner aus dem rumänischen Siebenbürgen großen Erfolg beim Lesepublikum in den deutschsprachigen Ländern. Kein Autor vor und aus seiner Generation (mit der Ausnahme von Oskar Pastior vielleicht ) konnte ähnliches Interesse über die Siebenbürger Gemeinschaft hinaus erwecken und wurde daher von außen als eine Art Stimme der jüngeren Geschichte dieser rumänischen Landschaft wahrgenommen. Dass dies nicht ohne Differenzierung zu betrachten war, zeigten die Romane Schlattners selbst wie aber auch die Auseinandersetzungen um ihren Wahrheitsgehalt: Denn wo die Romane sich auf historische Gegebenheiten bezogen, meldeten ebenso an dieser Realität teilhabende Personen scharfen Protest an. Schlattner wurde als Schuldiger an der Verurteilung von fünf Schriftstellerkollegen bezeichnet und als solcher in seiner Wahrhaftigkeit und gewissermaßen sein moralisches 'Recht' auf seinen Erfolg bezweifelt.
Liegen die in "Rote Handschuhe" geschilderten Vorgänge auch bereits mehr als fünf Jahrzehnte zurück, so entfalteten sie nach der politischen Wende von 1989 erst ihre explosive Kraft und historische Dimension. Plötzlich standen die Umstände der im stalinistischen Rumänien der 1950er Jahre statt gefundenen Verhaftung, des Prozesses und der Verurteilung in einem Schauprozess mitsamt seiner Instrumentalisierung von literarischen Texten wieder im Mittelpunkt hitziger Debatten und führten zur Wiederholung von alten oder zur Entstehung von neuen Lagerbildungen. Es hatte den Anschein, als würden hier noch einmal die tiefen Spaltungen der Siebenbürger Sachsen - etwa in den oft miteinander verbundenen Fragen: dem Regime widerstehen oder mitmachen, da bleiben oder gehen? - stellvertretend ausgefochten. Diese schwerwiegenden Probleme waren für die Geschichte der Siebenbürger im 20. Jahrhundert von entscheidender Bedeutung und fanden in Rumänien vielfach nur in mündlichen Diskussionen Raum, wenn die offene schriftliche und literarische Auseinandersetzung durch die Zensur behindert war. Vieles blieb ungesagt, unerforscht, unbelegt und machte die Vermittlung von klaren, differenzierten, aufklärenden Haltungen schwierig.
Um so mehr ist die vorliegende Dissertation von Michaela Nowotnick zu Schlattners Roman "Rote Handschuhe" und seiner Thematik zu begrüßen, die vor allem die Quellen sprechen lässt. Sich an eine größere akademische Öffentlichkeit wendend, die das Spezifische der Umstände kaum kennen dürfte, nähert sie sich ihrem Gegenstand von weit her. Nach einer methodischen und begrifflichen Umgrenzung ihrer Herangehensweise ist es ein klug gewählter historischer Abriss, der bereits deutlich macht, wie die Aktivitäten des jungen Studenten Schlattner als Begründer eines Lesekreises der deutschen Studenten an der Universität Klausenburg (Cluj) und Autor von Erzählungen sich in eine politische Situation hineinmanövrierte, die im stalinistischen kommunistischen Regime sowohl von dem ungarischen Aufstand von 1956, besonders aber auch der "sächsischen" Vergangenheit geprägt war. So kommen auch die Umstände des Zweiten Weltkriegs zur Sprache, in dem die Siebenbürger Sachsen als rumänische Staatsbürger in der verbündeten deutschen Waffen-SS, der Reichswehr oder der rumänischen Armee aktiv waren. Dies musste mit Rumäniens Kehrtwende auf die Seiten der Alliierten am 23. August 1944 ein besonderes Licht auf die nunmehrigen deutschen Gegner werfen. Enteignungen und Deportationen waren nach Machtübernahme der Kommunisten die Folge.
Nowotnicks stupende Quellenkenntnis inklusive des Zugangs zu Vorlass und Privatarchiv Schlattners lässt sie plausibel die Situation der jungen Sachsen in den Städten und an der Universität skizzieren, in der Schlattner sich literarisch und organisatorisch bemerkbar machte. Junge Intellektuelle wie Schlattner waren aufgefordert, sich zum Regime zu verhalten. Seine Möglichkeiten der Entscheidung wurden ihm aber durch die Verhaftung am 28.12. 1957 abrupt genommen. Zwei Jahre saß er in Securitate-Haft, nach mehreren Monaten hielt der bereits früher wegen psychischer Probleme medizinisch behandelte Student die Situation nicht mehr aus, und machte die gewünschten Angaben. In das Visier der Securitate waren sowohl der Literaturkreis als auch die Aktivitäten von deutschen Autoren geraten. Schlattner musste in einem politischen Schauprozess aussagen, der für fünf Angeklagte mit hohen Gefängnis- und Lagerstrafen endete (sie wurden nach ca. 5 Jahren begnadigt). Ihm selbst wurde ebenso der Prozess gemacht und die zwei Jahre Haft angerechnet, so dass er fast auf den Tag genau nach zwei Jahren in die Freiheit entlassen wurde.
Nowotnick zeichnet sehr genau die Funktionsweise des politischen Prozesses nach, wenn auch konkrete Aussagen aus den Prozessakten selten zitiert werden. In dem Prozess spielte eine nicht geringe Rolle ein von Germanisten aus Temeswar angefertigtes "Gutachten", in dem die Texte der fünf Schriftsteller als systemfeindlich interpretiert wurden.
Mit diesen Differenzierungen zur historischen Situation und Schlattners Entwicklung ist die Reflexion über den Status des Romans "Rote Handschuhe" vorbereitet. Denn das Buch hatte seine starke Wirkung, weil es sowohl autobiographisch als auch romanhaft schien und damit in den unterschiedlichen Debatten fast beliebig verwendet werden konnte. Mit literaturwissenschaftlichen Theorien zu Autobiographie und Autofiktion werden genauere Bestimmungen des Romans versucht, die aber letztlich auf die Herangehensweise des Lesers abheben: "Dabei kommt es immer auf den Standpunkt des Lesers an und inwiefern er den autofiktionalen Pakt mit dem Text schließt." (205) Die geschlossenen 'Echokammern', in denen Schlattner und sein Buch verhandelt wurden, bewegten sich weitgehend in der prekären Spannung von Moral und Ästhetik, die der Roman nicht entscheiden kann, sondern in der er jeweils dienstbar gemacht wird. Notwendig wäre eine scharfe Trennung der literarischen Autofiktion von einer distanziert-kritischen, ihrer Grenzen bewussten Geschichtsschreibung, wie sie im historischen Abriss Nowotnicks angedeutet ist. In dieser hätte der Roman seine eigene, klar umrissene Stelle.
Im letzten Kapitel sind die Folgen der Schwemme an autobiographischer Zeitzeugenliteratur aus rumäniendeutschen Federn in der Rezeption von "Rote Handschuhe" minutiös nachgezeichnet. Die Debatten laufen meist auf eine Verdammung oder ein Missverständnis des Romans hin - Verdammung, da man den Autor für einen Verräter, Spitzel oder anderes mehr hält oder weil man von der Unterscheidung zwischen Fiktion und Fakten keinen Gebrauch machen kann/will. Auch hier zeichnet die Autorin zahlreiche Linien der Diskussion differenziert nach und räumt mit manchen Mythen auf.
Ein ausführliches Interview mit Schlattner zu den im Buch verhandelten Themen kann als weitere Quelle im Anhang nachgelesen werden.
Michaela Nowotnick: Die Unentrinnbarkeit der Biographie. Der Roman "Rote Handschuhe" von Eginald Schlattner als Fallstudie zur rumäniendeutschen Literatur. Böhlau Verlag Köln, Weimar, Wien 2016 (Studia Transylvanica, Bd. 45), 359 Seiten, vier Abb., ISBN 9783412503444

Übersetzungskulturen
Von den Voraussetzungen und Untiefen der geisteswissenschaftlichen Kommunikation
Wer war Vlad Boțulescu von Mălăiești? Als Gefangener in der Burg der Sforza in Mailand übersetzte vor über 250 Jahren der rumänische Gelehrte eine deutsche Universalgeschichte ins Rumänische. Der Verfasser sollte sein Gefäng-nis nicht mehr verlassen, das Manuskript wurde erst vor fünf Jahren in Bukarest teil-veröffentlicht. Mit diesem alten und unbe-kannten Beispiel der Übertragung historiographischer und philosophischer Konzepte eröffnen Emanuela und Andrei Timotin in diesem Band das erste Kapitel von Reflexionen über den Transfer philosophischer Begriffsbildung in die rumänischen Sprach- und Denktraditionen. Solche Transfers implizieren – wie man den Beiträgen und auch den ausführlichen Rezensionen zur postkolonialen Theorie (Ana-Maria Pălimariu, Dragoș Carasevici, Alexanda Chirica) entnehmen kann – enorme Unwägbarkeiten, ja sie erscheinen eigentlich so unmöglich wie eine reine, völlig störungsfreie Kommunikation. Und dennoch zeichnet menschliche Geschichte der immer wieder gemachte Versuch aus, das Eigene zu überschreiten und „in Kontakt“ mit dem Nicht-Eigenen zu treten. Der von der Wiener Philosophin Mădălina Diaconu und dem Iașier Germanisten Andrei Corbea-Hoișie herausgegebene, mehrsprachige Sammelband geht intensiv diesen Schwierigkeiten wie auch den Erfahrungen des Übersetzens nach.
In der ersten Abteilung folgen auf die Eröffnung mit Boțulescu die Klassiker: Kant, Hegel, Kritische Theorie. Ioan Oprea (englisch) zeichnet die Linien der Entwicklung in den Donaufürstentümern nach, wo in Iași und Bukarest Kant und später Hegel durch Lehre und Übersetzung von deren Schülern Terrain gewannen; dies aber war nur möglich durch die rationalistische Aufklärung, die die „Școala Ardeleană” von Siebenbürgen über die Karpaten brachte (Barnuțiu, Murgu, Laurian, Pumnul). Mădălina und Marin Diaconu exponieren in ihrer Übersicht der Kant-Rezeption in Rumänien den Politiker und Juristen Titu Maiorescu als bedeutendsten Kantianer Ende des 19. Jahrhunderts. Für das 20. Jahrhundert bündelt George Bondor (französisch) die philosophisch-konzeptuellen Linien in vier Modellen: rationalistisch (Vasile Conta), romantisch (Constantin Noica), exis-tenzialistisch (Nae Ionescu, Nicolae Steinhardt, Mircea Vulcanescu). Nur dem im Westen ja durchaus vorhandenen marxistischen Modell schreibt Bondor keine Vertreter zu, sondern sieht für jeden ernsthaften Denker im rumänischen Kontext der kommunistischen Zensur das Problem der verdeckten Schreibweise. (Bondor übergeht damit die sozialistische Theoriebildung, etwa durch Dobrogeanu-Gherea am Ende des 19. Jahrhunderts.). Dem jüngeren Kritiker und Autor Alex Cistelecan (englisch) fehlen in den rumänischen Philosophiedebatten die Vertreter der Kritischen Theorie, wie er nicht zuletzt an den entsprechenden Sektionen der Buchhandlungen beobachtet, und weist zugleich auf Ausnahmen hin, etwa den Verlag „Idea” in Cluj.
Spiel(t)en in diesen Rezeptionen und Anschlüssen an deutsche Philosophen deren Übersetzungen neben der Universitätslehre die zentrale Rolle, so fokussiert das nächste Kapitel des Bandes näher auf einige Beispiele rumänisch-deutscher Übersetzungen im diachronischen Schnitt von Meister Eckhart bis Tudor Vianu. Wie werden anderssprachige Theorien und Schulen Rumänischlesenden präsentiert? Hier werden einige der generellen Probleme der Übersetzung deutlich. In einem erfreulich ausführlichen und in elegantem Französisch verfassten Beitrag zu den Übersetzungen Siegmund Freuds ins Französische und Rumänische hebt Magda Jeanrenaud einige der zentralen Probleme hervor: Anders als in Frankreich gibt es in Rumänien keine lebhaften Debatten, wie man Freud übersetzen solle (Freuds Lehre hat vor dem Hintergrund einer religiösen Orthodoxie keine große Anängerschaft in Rumänien ausgebildet). Zudem entwerfen die ÜbersetzerInnen selbst keine theoretischen Modelle hinsichtlich ihrer Herangehensweise, die ihre Übersetzung einheitlicher und überzeugender machen könnten.
Auch Gabriel Horațiu Decuble vermerkt in rumänischen Übersetzungen Meister Eckharts wenig Bewusstsein für ontologische Konzepte, die bestimmte Übersetzerentscheidungen motivieren könnten. Ion Tănăsescu geht in seinem kurzen, aber prägnanten Beitrag dem Verständnis des für die Phänomenologie zentralen Begriffs der „Intention(alität)“ bei Franz von Brentano nach – ein Begriff, der seine untergründige Rolle durch den gesamten Band spielt. Welche Problematik in umgekehrter Richtung vom Rumänischen ins Deutsche Übersetzungen bieten, diskutiert Elisabeth Berger am Beispiel der Metapherntheorie des Klassikers Tudor Vianu und deren kongenialen Übersetzung durch den Siebenbürger Sachsen Dieter Roth. In einem spannenden, bisweilen sprachlich aber etwas ungenauen Dokumentationsbeitrag von Larissa Schippel und Julia Richter zum "Übersetzungsdienst Wien" während des Zweiten Weltkriegs findet sich die (bibliographische) Gleichstellung von Autor und Übersetzerin – auch ein Beitrag zum philosophischen Problem, was eine Übersetzung und welche die Rolle der ÜbersetzerInnen als Textproduzent sei.

Vergessen, verdrängt, verschwunden
Die Publikation der 11. Tagung des Balkanromanistenverbands
Die Balkanromanistik bildet einen Teil des großen Universitätsfaches der Romanistik. Ihr Forschungsgebiet umfasst nachlateinische Spuren auf der Balkanhalbinsel, zu denen natürlich vor allem die rumänische Sprache und Kultur, hier auch die Relikte der früheren Verbreitung bzw. Entstehung des Rumänischen auf dem Balkan gehören - also u.a. das Istrorumänische, Mazedorumänische, Meglenoaromunische und Aromunische. In der deutschen Universitätslandschaft nur mit wenigen festen Stellen ausgestattet stellt der Verband der Balkanromanisten mit seinen Tagungen und Publikationen ein wichtiges Forum für die Forschungen zur rumänischen Kultur dar. Die Beiträge der Tagung im Jahr 2014 widmeten sich dem Thema der vergessenen, verdrängten und verschwundenen balkanromanischen Kulturen. "Welche Spuren aber hinterließen die Walachen in der Tatra, in den Beskiden, in Bosnien, auf der Peleponnes? Was wissen wir über die sprachliche Zugehörigkeit der Maurowalachen oder Morlaken, die in den Küstengebieten Bosniens, Kroatiens und Montenegros lebten und in den Slawen aufgingen?" fragen die HerausgeberIn im Vorwort.
Sprachwissenschaftlich beschäftigen sich mehrere Aufsätze mit der komplexen Situation in Istrien und Dalmatien.
Hier gab es venezianischen, toskanisch-italienischen, dalmatischen aber auch rumänischen Einfluss auf slawische, griechische und albanische Sprachentwicklung - und vice versa. Jürgen
Kristophson versucht sich anknüpfend an Forschungen von Ž. Muljačić an einer genaueren Beschreibung des Dalmatischen und seiner romanischen Einflüsse und kommt zu dem
Ergebnis, das es sich um ein "Ensemble romanischer Dialekte" handelte, die durch die "Dominanz Venedigs in den Status lokal begrenzter Restsprachen abgedrängt wurden". In dieser Forschung spielen
die alten Quellen der Sprachreste eine entscheidende Rolle. So gibt es für das Vegliotische nur eine Beschreibung durch Bartolie 1906, der den letzten Sprecher befragte:
"A. Udina (Udaina) erlernte das Vegliotische von seinen Großeltern, seine Muttersprache war Venezianisch. Außerdem beherrschte er Italienisch, angeblich auch Friaulisch, und
Kroatisch. Allerdings war Udaina taub und hatte wenige Zähne, war also nicht der ideale Informant."

„??“ oder Der Große Anonyme
Am Ende seiner Überlegungen zur Metaphysik kommt der rumänische Poet und Philosoph Lucian Blaga (1895-1961) nicht umhin, zu fragen, ob der von ihm angenommene und durchgehend als „Der Große Anonyme“ bezeichnete Urgrund des Denkens nicht mit dem Epitheton „Gott“ versehen werden müsse. Und antwortet: „ein Beiwort von äußerster idealisierter Rafinesse“, das er aber ablehnt, nicht zuletzt, weil er es nicht für ausgeschlossen hält, „dass er auch abgründige Eigenschaften hat, die viel an 'Dämonie' mit sich führen.“ Was den als „Faust“-Übersetzer und Lyriker zum modernen rumänischen Klassiker erhobenen Siebenbürger dazu führt, sein Modell der Metaphysik mit der Annahme eines „Großen Anonymen“ zu begründen – als einer gesetzten Ausgangshypothese, von der aus sich erst überhaupt das Nachdenken über Erkenntnis ermöglicht. Er kommt dabei auch auf einen - etwa auch seinen Fast-Generationsgenossen Walter Benjamin beschäftigenden - ontologischen Grund der Erkenntnis, den Benjamin nicht Blaga unähnlich ausgehend von einer virtuell-paradiesischen Erkenntnis konstruiert. Aber wo Benjamin die Verwirrung durch die Vertreibung aus dem Paradies weiter denkt, insistiert Blaga auf einem unzugänglichen großen Plan des Demiurgen, dessen Auswirkungen er u.a. in den seinerzeit aktuellen biologischen Erkenntnisproblemen (Driesch) diskutiert. Entscheidend ist innerhalb seines ausgearbeiteten Denkens die hier entfaltete „transzendente Zensur“, die einerseits erst menschliche Erkenntnis ermöglicht und zugleich in ihren Schranken hält, um den Großen Anonymen in seinen Rechten zu belassen. Rainer Schuberts flüssige Übersetzung lässt einen eigenwilligen Beitrag zur Metaphysik erkennen, der sich in Teilen explizit als Antwort auf Ludwig Klages und Max Scheler versteht.
Lucian Blaga: Die transzendente Zensur. Aus dem Rumänischen übersetzt von Rainer Schubert. Frank&Timme Berlin 2015 (Forum: Rumänien 27), 223 Seiten, ISBN 978-3-7329-0161-6
Originalausgabe: Lucian Blaga, Cenzura transcendentă: Încercare metafizică. Bucureşti: Cartea Românească 1934.
